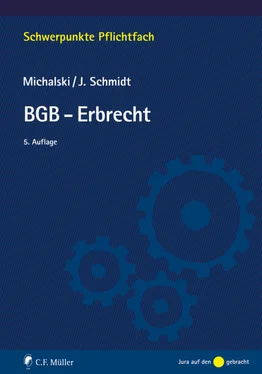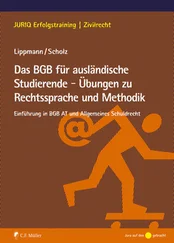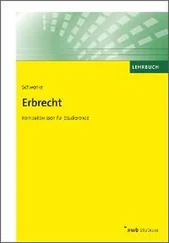Literatur:
Finger , Lebenspartnerschaft und Wohnung, WuM 2000, 462; Grziwotz , Erbrechtliche Gestaltungen bei gleichgeschlechtlichen Paaren, ZEV 2002, 55; Kaiser , Pflichtteilsrecht der eingetragenen Lebenspartner, FPR 2005, 286; Kamps , Eingetragene Lebenspartnerschaften, ErbStB 2005, 68; Muscheler, Die Eingetragene Lebenspartnerschaft nach deutschem Recht, JURA 2004, 217; Schwab , Eingetragene Lebenspartnerschaft – Ein Überblick, FamRZ 2001, 385.
118
Aufgrund des LPartG[1] konnten gleichgeschlechtliche Paare seit dem 1.8.2001 eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Nach Einführung der „Ehe für alle“ durch Gesetz v. 20.7.2017[2] können jedoch seit dem 1.10.2017 keine neuen eingetragenen Lebenspartnerschaften mehr begründet werden. Bereits bestehende eingetragene Lebenspartnerschaften bleiben indes unberührt: § 20a LPartG ermöglicht zwar die Umwandlung in eine Ehe; sofern die Partner hiervon keinen Gebrauch machen, besteht die eingetragene Lebenspartnerschaft jedoch fort.[3]
Die erbrechtlichen Regelungen des LPartG werden daher nur noch für diese „Altfälle“ relevant und entsprechen im Übrigen denjenigen für Ehegatten:
| Gesetzliches Erbrecht neben Verwandten |
Ehegatte |
Lebenspartner |
| 1. Ordnung |
ein Viertel |
| § 1931 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 |
§ 10 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 LPartG |
| 2. Ordnung |
Hälfte |
| § 1931 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 Alt. 1 |
§ 10 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 Alt. 1 LPartG |
| Großeltern des EL |
Hälfte; soweit auch Abkömmlinge von Großeltern vorhanden sind, erhält der Ehegatte/Lebenspartner zudem auch deren Anteile |
| § 1931 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 Alt. 2, S. 2 |
§ 10 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 Alt. 2, S. 2 LPartG |
| 4. und fernere Ordnungen |
Alleinerbe |
| § 1931 Abs. 2 |
§ 10 Abs. 2 S. 1 LPartG |
| Ausschluss während Scheidungs-/Aufhebungsverfahren |
§ 1933 |
§ 10 Abs. 3 LPartG |
| Zugewinngemeinschaft |
|
|
| Erhöhung des gesetzlichen Erbteils um 1/ 4 |
§ 1371 Abs. 1 |
§ 6 S. 2 LPartG i.V.m. § 1371 Abs. 1 |
| Voraus |
§ 1932 |
§ 10 Abs. 1 S. 3-5 LPartG |
| Güterrechtliche Lösung (Zugewinnausgleichsanspruch + kleiner Pflichtteil) |
§ 1371 Abs. 2 |
§ 6 S. 2 LPartG i.V.m. § 1371 Abs. 2 |
| Sonderregelung zur Ausschlagung |
§ 1371 Abs. 3 |
§ 6 S. 2 LPartG i.V.m. § 1371 Abs. 3 |
| Ausbildungsanspruch der Stiefkinder |
§ 1371 Abs. 4 |
§ 6 S. 2 LPartG i.V.m. § 1371 Abs. 4 |
| Gütertrennung |
§ 1931 Abs. 4 |
§ 10 Abs. 2 S. 2 LPartG |
| Gütergemeinschaft |
§§ 1471 ff. |
§ 7 S. 2 LPartG i.V.m. §§ 1471 ff. |
[1]
Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz – LPartG) v. 16.2.2001, BGBl. I, 266. Dazu Dethloff NJW 2001, 2598 ff.; Muscheler JURA 2004, 217 ff.; Schwab FamRZ 2001, 385 ff.
[2]
Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts v. 20.7.2017, BGBl. I, 2787. Dazu Engelhardt NZFam 2017, 1042 ff.; Kiehnle/Binder NZFam 2017, 742 ff.; Löhnig NZFam 2017, 977 ff.; Mankowski IPRax 2017, 541 ff.; Schwab FamRZ 2017, 1284 ff.
[3]
Vgl. BegrRegE BT-Drs. 18/6665, S. 9.
Teil II Die gesetzliche Erbfolge› § 5 Das gesetzliche Erbrecht von nichtehelichen Kindern
§ 5 Das gesetzliche Erbrecht von nichtehelichen Kindern
Literatur:
Dutta, Die rückwirkende Gleichstellung der vor dem 1. Juli 1949 geborenen Nichtehelichen im Erbrecht: Der deutsche Gesetzgeber zwischen Skylla und Charybdis, ZfPW 2018, 129; Leipold , Neue Erbchancen für „alte“ nichteheliche Kinder: der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und der BGH beseitigen die Diskriminierung, ZEV 2017, 489; Lieder/Berneith , Zum Erbrecht vor dem 1. Juli 1949 geborener nichtehelicher Kinder: Teleologische Erweiterung von Art 5 S. 2 ZwErbGleichG, FamRZ 2017, 1623; Weber, Das Erbrecht von vor dem 1.7.1949 geborenen nichtehelichen Kindern – Relaunch 2017, NotBZ 2018, 32
119
Bei allen ab dem 1.4.1998eingetretenen Erbfällen bestehen aufgrund des ErbGleichG[1] keine erbrechtlichen Unterschiedemehr zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern.
Allerdings blieb es für vor dem 1.7.1949 geborene nichteheliche Kinder zunächst beim generellen Ausschluss des Erbrechts. Sie wurden erst nach einer Entscheidung des EGMR[2] durch das ZwErbGleichG[3] erbrechtlich gleichgestellt – allerdings nur für Erbfälle, die sich ab dem 28.5.2009 ereigneten. Nachdem der EGMR dies – anders als zuvor BGH[4] und BVerfG[5] – in ähnlich gelagerten Fällen als Verletzung von Art. 14 EMRK (Diskriminierungsverbot) i.V.m. Art. 8 EMRK (Familienleben) qualifiziert hatte[6], entschied der BGH jedoch mit Beschluss v. 12.7.2017[7], dass in bestimmten Fällen eine teleologische Erweiterung von Art. 5 S. 2 ZwErbGleichG dahin geboten ist, dass die betreffenden Kinder ehelichen Kindern gleichgestellt werden.
[1]
Gesetz zur erbrechtlichen Gleichstellung nicht ehelicher Kinder (Erbrechtsgleichstellungsgesetz – ErbGleichG) v. 16.12.1997, BGBl. I, 2968.
[2]
EGMR v. 28.5.2009 – 3545/04, ZEV 2009, 510.
[3]
Zweites Gesetz zur erbrechtlichen Gleichstellung nichtehelicher Kinder, zur Änderung der Zivilprozessordnung und der Abgabenordnung v. 12.4.2011, BGBl. I, 615.
[4]
BGH v. 26.10.2011 – IV ZR 150/10, NJW 2012, 231.
[5]
BVerfG v. 18.3.2013 – 1 BvR 2436/11, 1 BvR 3155/11, NJW 2013, 2103.
[6]
EGMR v. 9.2.2017 – 29762/10, FamRZ 2017, 656.
[7]
BGH v. 12.7.2017 – IV ZB 6/15, ZEV 2017, 510. Dazu Adamus jurisPR-FamR 7/2018, Anm. 8; Dutta ZfPW 2018, 129 ff.; Leipold ZEV 2017, 489 ff.; Lieder/Berneith FamRZ 2017, 1623 f.; Weber NotBZ 2018, 32 ff.
Teil II Die gesetzliche Erbfolge› § 6 Das gesetzliche Erbrecht des Staates
§ 6 Das gesetzliche Erbrecht des Staates
Inhaltsverzeichnis
I. Funktion und Rechtsnatur
II. Voraussetzungen
III. Die Feststellung des Fiskuserbrechts
IV. Erbberechtigter Fiskus
V. Inhalt und Besonderheiten des Fiskuserbrechts
VI. Das gesetzliche Erbrecht des Staates aus internationalprivatrechtlicher Perspektive
120
Fall 5:
Der unglückselige A hat sich durch schlechte Geschäfte hoffnungslos überschuldet. Bevor er sich das Leben nimmt, setzt er ein Testament auf, in welchem er seine Frau und seine Kinder enterbt, um sicherzugehen, dass die Schulden der Familie nicht zur Last fallen. An wen können sich die Nachlassgläubiger halten? Lösung → Rn. 134
Fall 6:
Verwandte des Erblassers B werden Gerüchten zufolge irgendwo in den USA oder Brasilien vermutet. Zu welchem Zeitpunkt können die Nachlassgläubiger gegen wen Rechte geltend machen? Lösung → Rn. 135
Fall 7:
Der Erblasser C hatte in seinem Testament erklärt, dass sein einziger Sohn S bis auf die Briefmarkensammlung sein Erbe sein soll. Die Briefmarkensammlung hat einen Wert von 30.000 €, was etwa 40 % des Wertes des gesamten Nachlasses ausmacht. Andere gesetzliche Erben als S sind beim Tod des C nicht vorhanden bzw. nicht zu ermitteln. Wer erbt die Briefmarkensammlung? Lösung → Rn. 136
Читать дальше