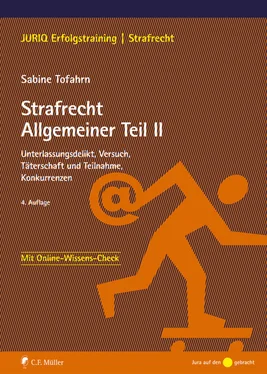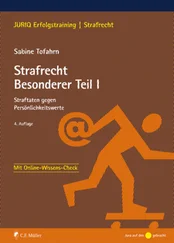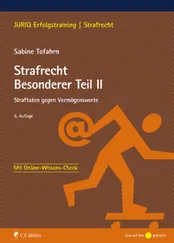Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: info@juriq.de.
zurück zu Rn. 48, 93, 155, 190, 218
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. Teil Einleitung
2. Teil Versuch und Rücktritt des Alleintäters
A. Überblick
B. Versuch
I. Vorprüfung
II. Tatentschluss
III. Untauglicher Versuch in Abgrenzung zum Wahndelikt
IV. Unmittelbares Ansetzen
C. Rechtswidrigkeit und Schuld
D. Rücktritt vom Versuch
I. Überblick
II. Fehlgeschlagener Versuch
III. Außertatbestandliche Zielerreichung
IV. Abgrenzung unbeendeter/beendeter Versuch
V. Rücktritt vom unbeendeten Versuch
VI. Rücktritt vom beendeten Versuch
VII. Rücktritt vom beendeten untauglichen Versuch
VIII. Freiwilligkeit
E. Übungsfall Nr. 1
3. Teil Das Unterlassungsdelikt
A. Überblick
B. Objektiver Tatbestand
I. Unterlassen der gebotenen Handlung
II. Abgrenzung positives Tun – Unterlassen
III. Abgrenzung täterschaftlichen Unterlassens von der Beihilfe durch Unterlassen
IV. Kausalität und objektive Zurechnung
V. Die Voraussetzungen des § 13
1. Garantenstellung
a) Beschützer- oder Obhutsgarant
aa) Garantenstellung aus enger persönlicher Verbundenheit
bb) Garantenstellung aus anderen Lebens- oder Gefahrengemeinschaften
cc) Garantenstellung aus Vertrag
dd) Garantenstellung aus der freiwilligen Übernahme von Schutz- und Beistandspflichten
ee) Garantenstellung aus der Stellung als Amtsträger
b) Überwachergarant
aa) Garantenstellung aus einem schadensnahen Vorverhalten, sog. Ingerenz
bb) Garantenstellung aus Verkehrssicherungspflichten
cc) Garantenstellung aus dem In-Verkehr-Bringen von Produkten
dd) Garantenstellung aus der Pflicht zur Beaufsichtigung Dritter
ee) Garantenstellung aus der Herrschaft über eine Räumlichkeit
2. Entsprechungsklausel
C. Subjektiver Tatbestand
D. Rechtswidrigkeit
E. Schuld
F. Versuch und Rücktritt
I. Versuch
II. Rücktritt
G. Täterschaft und Teilnahme
H. Übungsfall Nr. 2
4. Teil Täterschaft und Teilnahme
A. Übersicht
B. Abgrenzung der Täterschaft von der Teilnahme
I. Materiell-objektive Theorie oder Tatherrschaftslehre
II. Subjektive Theorie
C. Mittäterschaft
I. Überblick
II. Deliktsspezifische Merkmale beim Mittäter
III. Gemeinsamer Tatplan
IV. Verursachungsbeitrag und Wertung dieses Beitrages
1. Sukzessive Mittäterschaft
2. Tätigkeit nur im Vorbereitungsstadium
V.Versuch und Rücktritt
1. Versuch
2. Rücktritt
D. Mittelbare Täterschaft
I. Überblick
II. Der „Normalfall“ der mittelbaren Täterschaft
1. Der Vordermann handelt objektiv nicht oder nicht voll tatbestandsmäßig
2. Der Vordermann handelt subjektiv nicht tatbestandsmäßig
3. Der Vordermann handelt gerechtfertigt
4. Der Vordermann unterliegt einem durch den Hintermann initiierten Erlaubnistatbestandsirrtum
5. Der Vordermann ist nicht schuldfähig
6. Der Vordermann handelt entschuldigt
7. Der Vordermann befindet sich in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum
III. Problematische Fälle
1. Absichtslos doloses und qualifikationslos doloses Werkzeug
2. „Täter hinter dem Täter“
a) Die Tatausführung erfolgt unter Ausnutzung eines gut organisierten Machtapparates (sog. „Schreibtischtäter“)
b) Der Hintermann ruft beim Vordermann einen Irrtum hervor, der sich auf die Strafbarkeit des Vordermannes nicht auswirkt
IV. Mittelbare Täterschaft durch Unterlassen
V. Irrtümer
1. Error in persona des Vordermannes
2. Der Hintermann glaubt, er sei Anstifter während er tatsächlich mittelbarer Täter ist
3. Der Hintermann glaubt, er sei mittelbarer Täter, wohingegen der Vordermann jedoch vorsätzlich und rechtswidrig handelt
VI. Versuch und Rücktritt
E. Übungsfall Nr. 3
F. Anstiftung und Beihilfe
I. Überblick
II. Gemeinsamkeiten von Anstiftung und Beihilfe
1. Akzessorietät der Teilnahme
2. Akzessorietätsdurchbrechung
3. „Doppelter“ Teilnehmervorsatz
III. Anstiftung
1.Bestimmen
a) Begriffsbestimmung
b) Omnimodo facturus
aa) Umstiftung
bb) Aufstiftung
cc) Abstiftung
2.Vorsatz
a) Inhalt und Umfang
b) Exzess und error in objecto vel persona
IV. Beihilfe
1.Hilfeleisten
a) Begriffsbestimmung
b) Beihilfe durch neutrale Handlungen
c) Sukzessive Beihilfe
2. Vorsatz
V. Kumulierte Beteiligungshandlungen
VI. Versuchte Teilnahme
1. Versuchte Anstiftung gem. § 30 Abs. 1
2. § 30 Abs. 2
G. Übungsfall Nr. 4
5. Teil Konkurrenzen
A. Überblick
B. Die Handlung
I. Die Handlung im natürlichen Sinn
II. Die Handlung im juristischen Sinn
1. Tatbestandliche Handlungseinheit
2. Natürliche Handlungseinheit
C. Idealkonkurrenz
D. Realkonkurrenz
E. Gesetzeseinheit
I. Spezialität
II. Subsidiarität
III. Konsumtion
F. Mitbestrafte Vor- und Nachtat
I. Mitbestrafte Vortat
II. Mitbestrafte Nachtat
6. Teil Wahlfeststellung
A. Überblick
B. Echte Wahlfeststellung
C. Unechte Wahlfeststellung
D. Post- und Präpendenz
Sachverzeichnis
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 2 Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen
Читать дальше