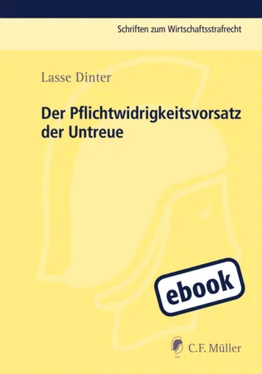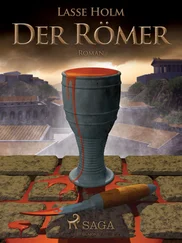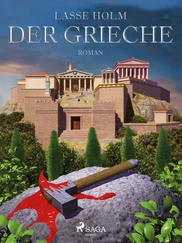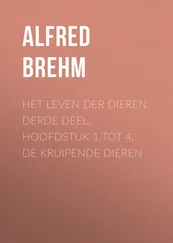„Wer als Verwalter fremden Vermögens in Kenntnis seiner Vermögensfürsorgepflicht eine Maßnahme trifft, die dem Inhaber des betreuten Vermögens keinen Vorteil bringen kann und deswegen einen sicheren Vermögensverlust bedeutet, kennt nicht nur die Tatsachen, die rechtlich als Verletzung der Vermögensfürsorgepflicht zu bewerten sind. Er weiß, weil das Verbot, alles das Vermögen sicher und ausnahmslos Schädigende zu unterlassen, zentraler Bestandteil der Vermögensfürsorgepflicht ist, vielmehr zugleich auch, dass er diese seine Pflicht verletzt.“[37]
Die Vorstellung der Täter, gleichwohl zur Gewährung von Anerkennungsprämien in genanntem Umfang berechtigt zu sein, fiele dann – wie der 3. Strafsenat zutreffend anmerkt[38] – in den Anwendungsbereich des § 17 und wäre Verbotsirrtum.
9
Der Rückschluss von der Behandlung des Irrtums über die Pflichtwidrigkeit in der Rechtsprechung auf die zutreffende Begriffskategorie des Pflichtwidrigkeitsmerkmals kann aber im Allgemeinen nur ein schwaches Indiz darstellen. Nicht sonderlich aussagekräftig ist er deshalb, weil zum einen nicht unerhebliche Unterschiede im Begriffsverständnis normativ geprägter Tatbestandsmerkmale bestehen können[39] und zum anderen die gängigen Irrtumsregeln der entsprechenden Tatbestandsmerkmale von der Rechtsprechung nicht konsequent angewendet werden. So wird § 370 AO zwar als Blankettstrafgesetz identifiziert („Steuerstrafrecht ist Blankettstrafrecht“[40]), Anwendung finden jedoch die Irrtumsfolgen eines normativen Tatbestandsmerkmals.[41]
Da sich der 3. Strafsenat des BGH ohnedies eines Rückgriffs auf „einfache“ Formeln ausdrücklich verschließen möchte, wird man aus der Rechtsfolge des Irrtums über die Pflichtwidrigkeit keinen zulässigen Schluss auf die möglicherweise zugrunde liegende dogmatische Einordnung des Pflichtwidrigkeitsmerkmals ziehen dürfen. Im Gegenteil, eine solche Handhabung könnte der vom Senat eingeforderten „differenzierenden“ Betrachtung widersprechen.
Teil 1 Einführung in die Problematik› B › II. § 266 als „Garantietatbestand“ (Art. 103 Abs. 2 GG)
II. § 266 als „Garantietatbestand“ (Art. 103 Abs. 2 GG)
10
Erheblich ist die Einordnung des Pflichtwidrigkeitsmerkmals zudem für die Garantiefunktion des Tatbestands. Ein Strafgesetz genügt danach nur dann dem aus Art. 103 Abs. 2 GG fließenden Gebot nullum crimen sine lege , wenn das verbotene Verhalten präzise bezeichnet wird.[42] Ist die Pflichtwidrigkeit normatives Tatbestandsmerkmal, findet Art. 103 Abs. 2 GG auf die von diesem Merkmal in Bezug genommenen Vorschriften keine Anwendung.[43] Den Anforderungen des Art. 103 Abs. 2 GG müsste allein der Straftatbestand genügen.[44] Wäre § 266 hingegen ein Blankettstrafgesetz, müssten sich sowohl der Straftatbestand als auch die Ausfüllungsvorschrift an Art. 103 Abs. 2 GG messen lassen.[45] Auf tatbewertende Merkmale findet der Bestimmtheitsgrundsatz dergestalt Anwendung, dass sich das außerrechtliche Werturteil mit der allgemeinen Überzeugung decken muss. Strafbarkeitsbegründend sind danach nur gesicherte (Wert-)Urteile; Einzel- und Sonderansichten bleiben außer Betracht.[46] Die Kategorisierung des Pflichtwidrigkeitsmerkmals erlangt mithin auch auf der objektiven Tatbestandsseite des § 266 Relevanz.
Teil 1 Einführung in die Problematik› C. Grundlagen
11
Die Identifizierung des Pflichtwidrigkeitsmerkmals in § 266 als normatives Tatbestandsmerkmal, als Blankett- bzw. tatbewertendes Merkmal erlangt für den gesetzlichen Tatbestand und Garantietatbestand nach überwiegender Ansicht zentrale Bedeutung. Zum Verständnis ist es daher sinnvoll, sich zunächst mit dem Tatbestand des § 266 und den grundlegenden Begrifflichkeiten näher vertraut zu machen.
Teil 1 Einführung in die Problematik› C › I. Der Tatbestand der Untreue, § 266 Abs. 1
I. Der Tatbestand der Untreue, § 266 Abs. 1
12
Der Tatbestand des § 266 ist unübersichtlich gestaltet. Nur mit Mühe sind die einzelnen Tatbestandsmerkmale der beiden Varianten herauszulesen. Das Verständnis der Strafvorschrift wird erleichtert, wenn die drei Satzteile gesondert betrachtet werden. Der erste Satzteil betrifft die „Missbrauchsvariante“ der Untreue:
Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, mißbraucht […].
Der zweite Satzteil wird als „Treubruchsvariante“ bezeichnet:
[…] oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eine Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt […].
Der dritte Satzteil bezieht sich im Ausgangspunkt auf beide Varianten:
[…] und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, […].
Lange Zeit war unklar, ob auch für die Missbrauchsvariante die aus dem Relativsatz des dritten Satzteils gelesene Vermögensbetreuungspflicht zu fordern ist. Die Antwort ist davon abhängig, ob dem Relativsatz im dritten Satzteil auch für die Missbrauchsvariante eigenständige Bedeutung zukommt und bejahendenfalls, ob sich die inhaltlichen Anforderungen an die Vermögensbetreuungspflicht in der Missbrauchs- und Treubruchvariante gleichen.
Während mittlerweile Einigkeit darüber herrscht, dass der Relativsatz ein selbstständiges Tatbestandsmerkmal in Form der „Vermögensbetreuungspflicht“ beschreibt und daher nicht etwa bloß formal die Person des Geschädigten bezeichnet,[47] ist die Frage nach den Anforderungen an die Vermögensbetreuungspflicht in der Missbrauchsvariante streitig geblieben. Dieses Rechtsproblem ist Ausdruck der Uneinigkeit darüber, ob die Missbrauchs- und die Treubruchvariante jeweils selbstständige Tatbestände bilden.
13
Die Untreuevarianten basieren auf zwei Theorien, mit denen vor Erlass des § 266 in jetziger Fassung im Jahre 1933[48] versucht wurde, das Wesen der Untreue etwa in Abgrenzung zur Unterschlagung herauszustellen: die sog. Missbrauchs- und die Treubruchtheorie.[49] Ausgangspunkt war die umstrittene Auslegung des § 266 Nr. 2 der seit 1871 bis 1933 geltenden Untreue-Fassung. Danach machte sich der „Bevollmächtigte“ strafbar, der „über Forderungen oder andere Vermögensstücke des Auftraggebers absichtlich zum Nachteil desselben [verfügte]“, wobei im Streit stand, ob der Täter rechtsgeschäftlich wirksam über fremde Vermögensstücke verfügt haben musste. Die Anhänger der sog. Missbrauchstheorie sahen das Wesen der Untreue in der Vermögensschädigung durch Missbrauch rechtlicher Vertretungsmacht,[50] bejahten mithin dieses Erfordernis. Demgegenüber fassten die Vertreter der sog. Treubruchtheorie das Wesen der Untreue weiter und erkannten in der Untreue die vermögensschädigende Verletzung der Rechtspflicht zur Fürsorge für fremdes Vermögen.[51] Danach reichte es aus, auch in anderer Weise als rechtsgeschäftlich nachteilig auf das Vermögen des Auftraggebers einzuwirken, um „Beauftragter“ zu sein.
In der Neufassung des § 266 vom 26. Mai 1933[52] wurden die beiden Theorien vom Gesetzgeber in Absatz 1 des § 266 übernommen. Fortan wurden die Untreuevarianten überwiegend als selbstständige Tatbestände qualifiziert[53] (sog. ältere dualistische Theorie[54]), bis der BGH im Jahre 1972 in der Scheckkarten -Entscheidung[55] auch für die Missbrauchsvariante eine dem Treubruchtatbestand entsprechende Vermögensbetreuungspflicht verlangte und damit der Ansicht das Wort sprach, wonach die Missbrauchsvariante lediglich ein Unterfall der Treubruchvariante sei (sog. monistische Theorie)[56]. Diese Ansicht findet bis heute breite Gefolgschaft auch in der Literatur, sodass die monistische Theorie als herrschend bezeichnet werden darf.[57]
Читать дальше