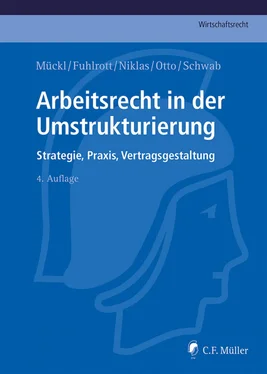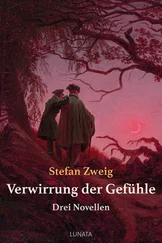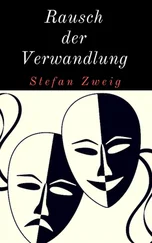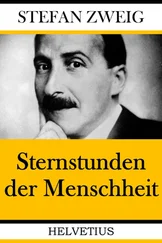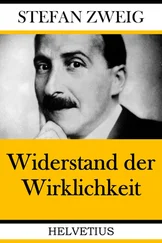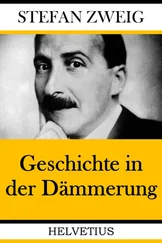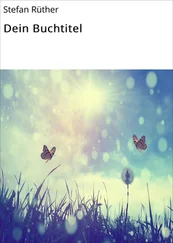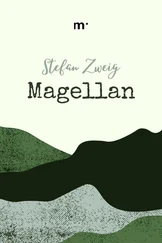d)Einführung und Beendigung von Holdingstrukturen
aa) Einführung Holdingstrukturen
bb) Beendigung von Holdingstrukturen
e) Einführung von Spartenorganisation und Matrixstrukturen
f) Einführung von sog. „Toller“-Modellen
5. Gesellschafterwechsel zur Mitbestimmungsgestaltung
6. Änderungen des Gesellschaftsvertrags
7. Formwechsel als Mittel zur Mitbestimmungsgestaltung
II. Zielsetzung: Minimierung gesellschaftsrechtlicher Einflussnahme auf die Umstrukturierung/sonstiger Risiken
1. Beachtung steuerlicher, kartellrechtlicher und regulatorischer Vorgaben
2. Vermeidung gesellschaftsrechtlicher Einflussnahme
3. Hoher gesellschaftsrechtlicher Aufwand für „geringen“ angestrebten arbeitsrechtlichen Effekt
4. Negative Auswirkungen auf wirtschaftliche Belastung durch Pensionsverbindlichkeiten bei der Wahl umwandlungsrechtlicher Lösungen
C. Arbeitsrechtliche Maßnahmen
I. Organisatorische Veränderungen/Betriebsänderung
1. Herausforderung: Beteiligung des zuständigen Betriebsrats
2. Größte Einflussnahmemöglichkeit der betrieblichen Arbeitnehmervertretung
a) Nachteilsausgleichsansprüche
b) Einstweilige Verfügung auf Unterlassung der Umsetzung der geplanten Betriebsänderung bis zum Abschluss der Verhandlungen
c) Praxisrisiko: Verkannte Betriebsänderung
II.Betriebsübergang
1. Bloßer Rechtsträgerwechsel
2. Große Einflussnahmemöglichkeit der Belegschaft
III. Mischformen (Betriebsänderung anlässlich eines Inhaberwechsels)
1. Übertragung eines Betriebsteils und separate Fortführung beim Erwerber (Outsourcing)
2. Spaltung in Anlage- und Betriebsgesellschaft
3. Neugründung/Eingliederung von Betrieb(steil)en beim Erwerber (Insourcing)
4. Shop-in-Shop-Modelle/Leiharbeit
5. Betriebsveräußerung mit Personalabbau
IV. Gegenstrategien der Unternehmensseite
1. Vorübergehender Gemeinschaftsbetrieb
2. Vermeidung von Zustimmungsverweigerungen oder Massenwidersprüchen durch gesellschaftsrechtliche Gestaltungsformen
3. Erleichterungen in der Insolvenz
a) Betriebsänderungen
b) Betriebsübergang
D. Wichtige sonstige (nicht rechtliche) Gesichtspunkte
E. Besonderheiten bei der Umstrukturierung und Privatisierung öffentlich-rechtlicher Rechtsträger
I. Umstrukturierung innerhalb des öffentlichen Dienstes
1. Erscheinungsformen der Umstrukturierung innerhalb des öffentlichen Dienstes
2. Betriebsübergang i.S.d. § 613a BGB
II. Privatisierungen
1. Maßgeblichkeit des gewählten Gestaltungsinstruments
2.Gestaltungsinstrumente im Überblick
a) Privatisierung durch Gesetz
b) Umwandlungsrechtliche Maßnahmen
c) Share Deal
d) Asset Deal
3.Typischerweise wichtige Gesichtspunkte
a) Betriebliche Altersversorgung
b) Betriebliche Mitbestimmung
2. Kapitel Umstrukturierung durch Betriebsänderungen
I. Einführung
II. Betriebsänderungen i.S.d. § 111 BetrVG
1.Allgemeine Voraussetzungen einer Betriebsänderung
a) Größe des Unternehmens
b) Wesentliche Nachteile für die Arbeitnehmer
c) Belegschaft oder erheblicher Teil der Belegschaft
d) Bestehen eines Betriebsrats
e) Tendenzbetriebe
2. Tatbestände des § 111 Satz 3 Nrn. 1 bis 5 BetrVG
a) Betriebsstilllegung
b) Stilllegung wesentlicher Betriebsteile
c) Einschränkung des Betriebs oder eines wesentlichen Betriebsteils
d) Betriebseinschränkung durch bloßen Personalabbau
e) Betriebsverlegung
f)Zusammenschluss und Spaltung von Betrieben
aa) Zusammenschluss
bb) Spaltung
g) Grundlegende Änderung der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks oder der Betriebsanlagen
h) Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren
i) Sonderfall: Betriebsübergang und Betriebsänderung
3.Beteiligung des Betriebsrates gemäß §§ 111 ff. BetrVG
a) Unterrichtung
aa) Zeitpunkt
bb) Inhalt, Form und Umfang der Unterrichtung
b) Beratung
c) Zuständiger Verhandlungspartner
d) Hinzuziehung eines Beraters
e)Interessenausgleichsverfahren
aa) Gegenstand, Inhalt und Form des Interessenausgleichs
bb) Die Einigungsstelle
f)Sozialplan
aa) Gegenstand, Erzwingbarkeit, Form
bb) Inhalt
cc) Transferregelungen
dd) Der Sozialplan in der Einigungsstelle
(1) Gegebenheiten des Einzelfalles
(2) Aussichten auf dem Arbeitsmarkt
(3) Förderungsmöglichkeiten
(4) Bemessung des Gesamtvolumens
g) Einigungsstellenverfahren
h) Änderung und Kündigung von Sozialplänen
4. Durchsetzbarkeit der Beteiligungsrechte gemäß §§ 111 ff. BetrVG
a) Unterlassungsanspruch
b) Nachteilsausgleichsansprüche gemäß § 113 BetrVG
III. Sonstige Beteiligungsrechte des Betriebsrates
1.Weitere umstrukturierungsrelevante Beteiligungsrechte nach dem BetrVG
a) Mitbestimmungsrechte nach § 87 BetrVG
b) Zustimmung zu Versetzungen und Einstellungen
c) Anhörung des Betriebsrats nach § 102 BetrVG
2. Beteiligungsrechte bei Massenentlassungen (§ 17 KSchG)
a) Anzeigepflichtige Entlassungen
b) Konsultationsverfahren
aa) Unterrichtung des Betriebsrates nach § 17 Abs. 2 KSchG
bb) Beratung
cc) Stellungnahme des Betriebsrats
c) Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die Beteiligungsrechte aus § 17 KSchG
IV. Beteiligungsrechte weiterer Organe der Betriebsverfassung
1. Beteiligungsrechte des Wirtschaftsausschusses
a) Inhalt des Beteiligungsrechts
b) Zeitpunkt
c) Streitigkeiten
2. Beteiligungsrechte des Sprecherausschusses
3. Beteiligungsrechte des Europäischen Betriebsrates
V. Konsequenzen einer Betriebsänderung für den Fortbestand des Betriebsrates
1. Abgrenzung zu bloßen Veränderungen auf Unternehmensebene
2. Zusammenschluss von Betrieben
3. Spaltung bestehender Betriebe
a)Folgen für bestehende Betriebsräte
aa) Abspaltung
bb) Aufspaltung
b)Besonderheiten bei Gemeinschaftsbetrieben
aa) Spaltung und Fortführung als gemeinsamer Betrieb
bb) Spaltung eines Gemeinschaftsbetriebs
c) Stilllegung
3. Kapitel Umstrukturierung und Übertragung durch Betriebsübergang
I. Einführung
1. Bedeutung in der Umstrukturierungspraxis
2. Normzweck und Entstehungsgeschichte
a) Schutz des sozialen Besitzstands im Sinne eines Arbeitsplatzerhalts
b) Sicherung der Kontinuität des bestehenden Betriebsrats
c) Gewährleistung der Fortgeltung kollektivrechtlicher Arbeitsbedingungen
d) Verteilung der Haftung zwischen Betriebsveräußerer und Betriebserwerber
II. Tatbestandliche Voraussetzungen
1. Betrieb und Betriebsteil
a) Betriebsbegriff
b) Betriebsteilbegriff
2. Identitätswahrender Übergang einer wirtschaftlichen Einheit
a) Typologische Begriffsbestimmung und Gesamtbetrachtung
b) Sieben-Punkte-Katalog
aa) Art des Unternehmens
bb) Übergang materieller Aktiva
cc) Wert immaterieller Aktiva
dd) Übernahme von Arbeitnehmern
ee) Übernahme von Kunden
ff) Ähnlichkeit der Tätigkeit
gg) Unterbrechung der Tätigkeit
3. Inhaberwechsel und maßgeblicher Zeitpunkt
4. Durch Rechtsgeschäft
III. Rechtsfolgen
1. Übergang bestehender Arbeitsverhältnisse
a) Zuordnung von Arbeitsverhältnissen
b) Einzelfragen übergehender Rechte und Pflichten
2. Schicksal kollektivrechtlicher Vereinbarungen
a) Betriebsvereinbarungen
aa) Kollektivrechtliche Fortgeltung von Betriebsvereinbarungen
bb) Transformation von Betriebsvereinbarungen und Veränderungssperre
cc) Ablösung von Betriebsvereinbarungen
Читать дальше