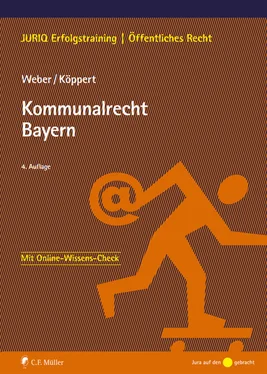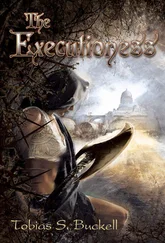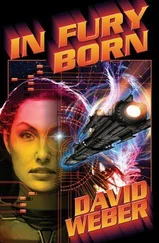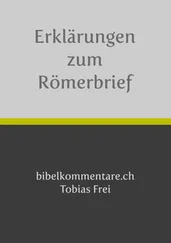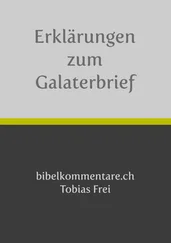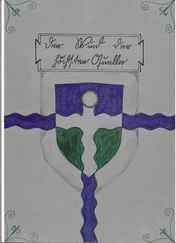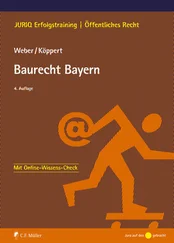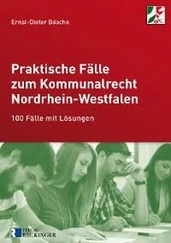III. Übungsfall Nr. 3
D. Die kommunalverfassungsrechtliche Streitigkeit
I. Begriff
II. Differenzierung nach Inter- und Intraorganstreit
III. Rechtsschutz
IV. Prüfungsschema
V. Übungsfall Nr. 4
5. Teil Handlungsformen der Gemeinde
A. Die Satzung als Rechtsetzungsakt im eigenen Wirkungskreis
B. Die Verordnung als Rechtsetzungsakt im übertragenen Wirkungskreis
C. Unterschiede zwischen Satzungen und Verordnungen
D. Rechtmäßigkeitsanforderungen an Satzungen
I. Formelle Anforderungen
1. Zuständigkeit
2. Verfahren
3. Form
II.Materielle Anforderungen
1. Ermächtigungsgrundlage
2. Vereinbarkeit mit der Ermächtigungsgrundlage und mit höherrangigem Recht
3. Exkurs: Inhaltliche Anforderungen an den Erlass von Rechtsverordnungen
4. Rechtsfolgen bei Verstößen
III. Überprüfung kommunaler Satzungen: Problem der Verwerfungskompetenz
IV.Rechtsschutz
1. Prinzipale Normenkontrolle, § 47 VwGO
2. Die Popularklage, Art. 98 S. 4 BV, Art. 2 Nr. 7, 55 BayVerfGHG
3. Gerichtliche Inzidentkontrolle
4. Bundesverfassungsbeschwerde, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, §§ 13 Nr. 8a, 90 ff. BVerfGG
5. Bayerische Verfassungsbeschwerde, Art. 120, 66 BV, Art. 2 Nr. 6, 51 ff. VerfGHG
6. Teil Die öffentlichen Einrichtungen
A. Begriff der öffentlichen Einrichtung
I. Organisatorische Möglichkeiten
II.Zugang zur öffentlichen Einrichtung
1. Zulassungsanspruch
2. Grenzen des Zulassungsanspruchs
a) Widmung
b) Kapazität
c) Gefahr von Rechtsverstößen
d) Sonderfall: Zulassung politischer Parteien zu öffentlichen Einrichtungen
III. Die Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses der öffentlichen Einrichtung
IV. Rechtsschutzmöglichkeiten des Bürgers
1. Rechtswegfrage
2. Statthafte Klageart
B. Der gemeindliche Anschluss- und Benutzungszwang
I. Begriff, Inhalt, Sinn und Zweck
II. Materielle Voraussetzungen
III. Räumliche Begrenzung
IV. Einschränkung von Grundrechten durch Anschluss- und Benutzungszwang
C. Kommunale Unternehmen
I. Organisationsformen
1. Öffentlich-rechtliche Organisationsformen
2. Privatrechtliche Organisationsformen
II. Zulässigkeitsanforderungen an gemeindliche Unternehmen
III. Rechtsschutz Dritter gegen gemeindliche Unternehmen (Konkurrentenklage)
7. Teil Die Staatsaufsicht über die Gemeinde
A. Prinzip der staatlichen Aufsicht über kommunale Gebietskörperschaften
B. Die Unterscheidung zwischen Rechts- und Fachaufsicht
C. Rechtsaufsicht
I. Die Rechtsaufsichtsbehörden
II. Die rechtsaufsichtlichen Aufsichtsmittel
1. Informationsrecht, Art. 111 GO
2. Beanstandungs- und Aufhebungsverlangen, Art. 112 S. 1 GO
3. Ersatzvornahme, Art. 113 GO
4. Bestellung eines Beauftragten, Art. 114 GO
III. Rechtsschutz der Gemeinde gegen rechtsaufsichtliche Maßnahmen
1. Rechtsnatur der Maßnahmen
2. Statthafte Klageart und Klagebefugnis
D. Fachaufsicht
I. Die Fachaufsichtsbehörden
II. Die fachaufsichtlichen Aufsichtsmittel
1. Informationsrecht, Art. 116 Abs. 1 S. 1 GO
2. Weisungsrecht, Art. 116 Abs. 1 S. 2 GO
3. Ersatzvornahme, Art. 116 Abs. 1 S. 3, 116 Abs. 2 S. 1 GO
III. Rechtsschutz der Gemeinde gegen fachaufsichtliche Maßnahmen
1. Rechtsnatur der fachaufsichtlichen Weisung
2. Statthafte Klageart und Klagebefugnis
3. Begründetheit einer Klage gegen einen aufsichtlichen Rechtsakt
E. Exkurs: Rechtsschutz des Bürgers bei aufsichtlichem Handeln
F. Übungsfall Nr. 5
8. Teil Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
A. Elemente unmittelbarer Demokratie in Bayern
B. Formelle Voraussetzungen für die Zulassung eines Bürgerentscheids
I. Antrag, Bestimmtheit der Fragen, Begründung
II. Unterzeichner, Vertreter des Begehrens, Quorum
C. Materielle Voraussetzungen für die Zulassung eines Bürgerbegehrens/Bürgerentscheides
D. Umfang der gemeindlichen Prüfung nach Art. 18a Abs. 8 GO
E. Rechtsfolgen eines zulässigen Bürgerbegehrens
F. Der Rechtsschutz auf Zulassung eines abgelehnten Antrages auf Bürgerbegehren/Bürgerentscheid
I. Allgemeines
II. Übungsfall Nr. 6
9. Teil Kommunale Zusammenarbeit
A. Gesetzliche Möglichkeiten kommunaler Zusammenarbeit nach dem KommZG und der VGemO
B. Arbeitsgemeinschaften, Zweckvereinbarungen, Zweckverbände
C. Die Verwaltungsgemeinschaft
I. Allgemeines
II. Aufgabendifferenzierung bei der Verwaltungsgemeinschaft
III. Organe der Verwaltungsgemeinschaft
IV. Aufsicht bei der Verwaltungsgemeinschaft
Sachverzeichnis
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 3 Leistungsfähigkeit, Ernährung und individueller Tagesrhythmus
Jura Lernen ist Kopfarbeit, die mit emotionalen und motivationalen Zuständen verbunden ist. Diese mentalen Prozesse sind physiologisch betrachtet elektrische Aktivität der Hirnzellen - also Körperarbeit. Und Körperarbeit erfordert und verbraucht Energie. Sie brauchen für eine erfolgreiche Lernarbeit eine angemessene Energiezufuhr durch passende Ernährung. Und weil es Tagesschwankungen in der Leistungsfähigkeit gibt, ist es für Sie wichtig, Ihre Lern- und Pausenplanung an einem individuell passenden Rhythmus auszurichten.
Lerntipps
Optimieren Sie Ihre Ernährung!
Zum Lernen ist es günstig, sich gut zu fühlen und geistig konzentriert zu sein. Nudeln zum Beispiel kurbeln das „Glückshormon“ Serotonin an und sind eine Langzeitenergiequelle, da der Körper die Kohlehydrate aus dem Mehl nur langsam abbaut. Aufmunternd wirken Brot, Fisch und Kartoffeln. Bananen wirken leicht beruhigend durch ihren Magnesiumgehalt. Durch zu wenig Nahrung sinkt der Blutzuckerspiegel ab, bewirkt eine Konzentrations- und damit Leistungsabnahme. Für das Gehirn sind daher kleinere Mahlzeiten (am besten fünf) optimal. Nicht umsonst wird von Ernährungsexperten nach wie vor das Schulbrot und ein Apfel empfohlen, auch wenn das bei vielen Schülern als uncool gilt. Denken Sie auch an Vitamine, besonders C, E und B und Mineralien wie Eisen und Calcium. Obst und Gemüse sind hier ideal.
Читать дальше