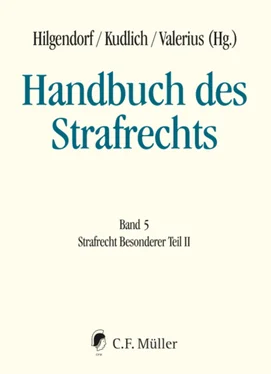46
Die Dauer des neuen Gewahrsams ist dabei unerheblich. Der Täter muss lediglich überhaupt kurzzeitig die Herrschaftüber die Sache innegehabt haben.[170] Auch bei einem baldigen Gewahrsamsverlust des Täters liegt eine Gewahrsamsbegründung vor. Die spätere Rückführung an den Eigentümer oder den ehemaligen Gewahrsamsinhaber ist grundsätzlich zwar bedeutungslos;[171] im Falle eines von Beginn an bestehenden Willens des Täters zur Rückführung der Sache ist indes die Zueignungsabsicht fraglich (vgl. unten Rn. 58 f.). Es bedarf auch keiner Begründung des Gewahrsams durch den Täter selbst, vielmehr genügt, wenn er einem Dritten den Gewahrsam verschafft oder diesen als Werkzeug zur Erlangung des Gewahrsams benutzt.[172] Gewahrsamsbruch und Begründung neuen Gewahrsams können u.U. auch einmal zeitlich auseinander fallen. Denkbar ist dies etwa, wenn der Täter die Diebesbeute aus einem fahrenden Zug wirft und diese erst später abholt. Bis zur Begründung neuen Gewahrsams ist hier nur von einem Versuch auszugehen.[173]
47
b)Befindet sich die Sache noch im fremden Herrschaftsbereich des alten Gewahrsamsinhabers, wie dies etwa in Selbstbedienungsläden[174] zunächst die Regel sein dürfte, ist der alte Gewahrsam an kleineren Gegenständen nur dann aufgehoben, wenn der ehemalige Gewahrsamsinhaber in die „Sphäre“ des Täters eindringen müsste, um seinen Gewahrsam wiederzuerlangen. In diesen Fällen spricht man von einer Gewahrsamsenklave, die der Täter begründet.[175] Zur Neubegründung des Gewahrsams genügt dann, dass der Täter die Sache an sich nimmt und dem Wegbringen der Sache keine wesentlichen Hindernisse mehr entgegenstehen.[176] Dies ist denklogisch nur bei kleineren Gegenständen möglich und etwa dann der Fall, wenn der Täter die Sache in seiner Kleidung versteckt oder in ein mitgeführtes Behältnis steckt.[177] Bei sehr kleinen Gegenständen reicht u.U. selbst schon das In-der-Hand-Halten aus.[178] Wie beim Gewahrsamsbruch ist es auch vorliegend ohne Belang, ob der Täter beobachtet wird.
48
Kein neuer Gewahrsam wird hingegen begründet, wenn Sachen in Behältnissen verstecktwerden, die noch der Kontrolle des alten Gewahrsamsinhabers unterliegen. Hier ist jederzeit ein Zugriff des alten Gewahrsamsinhabers möglich, weshalb z.B. das Verstecken der Sache im Einkaufswagen noch keinen neuen Gewahrsam begründet.[179] Dies geschieht erst, wenn der Bereich der bestimmungsgemäßen Kontrolle des Behältnisses[180] durchschritten wird oder spätestens mit dem vollständigen Verlassen des Geschäfts.[181] Der Täter muss bei mehreren oder sperrigen bzw. allgemein größeren Sachen den fremden Herrschaftsbereich ebenso verlassen haben, da es dem Täter vorher nicht möglich ist, diese Gegenstände in eine eigene Gewahrsamsenklave zu verbringen.[182]
49
Daher liegt i.d.R. noch kein neuer Gewahrsam vor, wenn der Täter die Sache innerhalb des fremden Herrschaftsbereichs versteckt, um sie später abzutransportieren, wobei natürlich die Umstände des Einzelfalls entscheidend sind. Kein Gewahrsamswechsel ist daher im Einstellen eines Buches in ein falsches Regal in einer Bibliothek gegeben, während dieser hingegen zu bejahen ist, wenn ein Schmuckstück zum späteren Abtransport in einen Müllsack gesteckt wird.[183] Bei Kraftfahrzeugen genügt zur Gewahrsamsbegründung das bloße Wegfahren bzw. Abschleppen,[184] wobei auch eine kurze Strecke ausreicht.[185]
50
c)Die Begründung neuen Gewahrsams (in Zueignungsabsicht) ist gleichbedeutend mit der Vollendungdes Diebstahls. Beendetist er dagegen erst, wenn der Täter den neuen Gewahrsam gefestigt und derart gesichert hat, dass die Tat zu ihrem endgültigen Abschluss gekommen ist.[186] Eine derartige „Beutesicherung“ ist insbesondere anzunehmen, wenn der Täter die Sache in seine eigenen Räume oder ein Versteck verbracht hat.[187] Besondere Relevanz hat die Unterscheidung zwischen Vollendung und Beendigung insbesondere für die Abgrenzung von § 249 und § 252 StGB sowie für die Frage nach einer möglichen sukzessiven Teilnahme am Diebstahl zwischen Vollendung und Beendigung sowie den Beginn der Verjährung.
III. Die überschießende Innentendenz beim Diebstahl: Zueignungsabsicht
51
Zusätzlich zu dem allgemeinen Vorsatzerfordernis muss der Täter auf subjektiver Ebene absichtlich, also mit zielgerichtetem Willen, hinsichtlich der rechtswidrigen Zueignung der Sache an sich oder einen Dritten handeln.[188] Hierin besteht das maßgebliche Kriterium zur Abgrenzung zwischen Diebstahl und bloßer Sachentziehung und Gebrauchsanmaßung, die (abgesehen von bestimmten Fällen, wie etwa solchen des § 248b StGB) grundsätzlich straflos sind.[189] Ob es tatsächlich zur Zueignung kommt, ist insoweit nicht maßgeblich, da es sich bei § 242 StGB um ein Delikt mit überschießender Innentendenzbzw. um ein erfolgskupiertes Delikt handelt. Entscheidend ist allein die subjektive Absicht des Täters dahingehend im Zeitpunkt der Wegnahmehandlung. Im Falle eines Irrtums des Täters über den weggenommenen Gegenstand, kann im Einzelfall die Zueignungsabsicht (jedoch nicht der Vorsatz als solcher) zu verneinen sein, womit die Vollendungsstrafbarkeit hinsichtlich der weggenommenen Sache entfiele, da er eine Sache in seinen Gewahrsam bringt, die er gar nicht haben wollte.[190]
52
Die Rechtswidrigkeit der angestrebten Zueignungist nach h.M. ein objektives Tatbestandsmerkmal, da sich die Absicht des Täters nur auf objektive Elemente beziehen kann.[191] Vgl. zu den damit zusammenhängenden Fragen näher unten Rn. 64 ff.
53
Unter Zueignung versteht man die Anmaßung einer eigentümerähnlichen Sachherrschaft(„se ut dominum gerere“), indem der Täter die Sache selbst oder den in ihr verkörperten Sachwert dem eigenen Vermögen einverleibt[192] und damit sich oder einen Dritten wirtschaftlich in die Lage des Eigentümers versetzt.[193] Die Zueignung hat zwei Voraussetzungen, die sich im Hinblick auf Dauerhaftigkeit und Vorsatzintensität unterscheiden: Es bedarf sowohl der Enteignung im Sinne einer dauernden Verdrängung des Eigentümers aus seiner Machtstellung und der Aneignung als wenigstens vorübergehende Einverleibung der Sache in das Vermögen des Täters oder eines Dritten.
a) Gegenstand der Zueignung
54
Was genau den Gegenstand der Zueignungdarstellt, ist umstritten. Streitpunkt hierbei ist, ob sich die Zueignung auf die Sache selbst oder auf den ihr innewohnenden Vermögenswert beziehen muss. Eine grobe Unterscheidung dieser Ansichten ist in die Substanz-, die Sachwert- und die Vereinigungstheorie möglich (wobei die beiden Erstgenannten in ihrer Reinform heute kaum noch vertreten werden). Der Streit hat vor allem im Rahmen der Enteignung Relevanz, genauer, wenn der Täter plant, die Sache zum Eigentümer zurückzuführen, sich zuvor aber dessen Wert ganz oder teilweise zuführen möchte (vgl. auch Rn. 60).[194]
55
Die Substanztheoriebezieht sich auf die Sache selbst, diese muss der Täter dem Eigentümer entziehen.[195] Teilweise erfährt die Theorie insoweit eine Modifikation, dass nicht auf die Sache selbst, sondern vielmehr auf die an ihr bestehenden Herrschaftsbefugnisse abgestellt wird, so dass auch der Entzug der der Sache innewohnenden Gebrauchs- und Funktionsmöglichkeiten ausreichend wäre.[196] Nach der Sachwerttheoriehingegen ist allein der in der Sache verkörperte Wert Gegenstand der Zueignung.[197] Es bedarf daher auch keiner dauernden Entziehung der Substanz der Sache gegenüber dem Eigentümer, solange der Täter ihren Wert teilweise oder vollständig entzieht. Bei wirtschaftlich wertlosen Sachen freilich scheidet diese Art der Zueignung aus, insoweit werden hier die Grenzen zwischen Eigentums- und Vermögensdelikten verwischt.[198]
Читать дальше