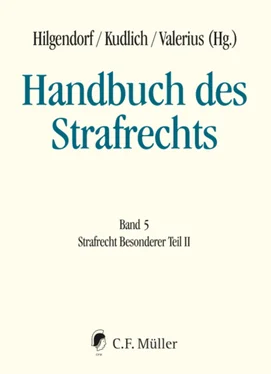42
Eine Vielzahl der Tatbestände, die abstrakte Gefährdungen von Vermögenswerten beschreiben, dienen jedoch in Wahrheit auch oder vorrangig dem Schutz von Institutionen.[148] So gewährleisten die eben genannten §§ 264a, 265 und 265b StGB nicht in erster Linie Vermögensrechte von Personen, sondern den Bestand gesellschaftlicher Institutionen wie des Versicherungs- und Kreditwesens oder des Kapitalmarktes.[149] Besonders deutlich zeigt sich dieses Phänomen im Bereich der Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben. Hiernach macht sich strafbar, wer als Sportler oder Trainer einen Vorteil dafür annimmt, dass er den Verlauf oder das Ergebnis eines berufssportlichen Wettbewerbs in wettbewerbswidriger Weise zugunsten des Wettbewerbsgegners beeinflusst. Nach der Begründung des Gesetzgebers geht von Manipulationen „eine erhebliche Gefahr für das Vermögen anderer aus“; bei „hochklassigen Wettbewerben mit berufssportlichem Charakter“ könnten „die am Wettbewerb beteiligten ehrlichen Sportler sowie Sportvereine, Veranstalter und Sponsoren Vermögensschäden erleiden“.[150] Sieht man den Regelungszweck des § 265d StGB im Schutz des individuellen Vermögens von Sportlern und Vereinen,[151] so muss die Gestaltung der Norm berechtigter Kritik begegnen. Eine Vermögenseinbuße wird tatbestandlich weder vorausgesetzt, noch ist sie notwendige Folge einer Manipulation sportlicher Wettbewerbe; schließlich ziehen sportliche Niederlagen nicht notwendigerweise unmittelbare wirtschaftliche Verluste nach sich. Eine Deutung des § 265d StGB als Vorfelddelikt zum Wettbetrug in § 265c StGB würde hingegen zu weit führen: Die Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe in § 265d StGB weist nach ihrem Wortlaut keinen Bezug zur Durchführung von Sportwetten auf und kann ganz anderen Zielen – etwa dem Klassenerhalt – dienen. Legitimiert wird § 265d StGB daher richtigerweise nicht durch individuelle Vermögensinteressen, sondern durch die Gewährleistung von Fairness und Integrität des Sports als sozialer Institution.[152] Der Schutz von Vermögen ist hier allenfalls ein erwünschter Reflex des Institutionenschutzes, nicht aber Wesensmerkmal der Norm.
8. Abschnitt: Schutz des Vermögens› § 28 Der Schutz des Vermögens im deutschen Strafrecht› E. Fazit: Zur Struktur des Vermögensstrafrechts
E. Fazit: Zur Struktur des Vermögensstrafrechts
43
Der Blick auf das deutsche Vermögensstrafrecht zeigt ein ambivalentes Bild. Seine Tatbestände stehen nicht beziehungslos nebeneinander, ihre Anordnung ist kein Produkt reinen Zufalls, sondern das Ergebnis eines historisch gewachsenen rechtlichen Schutzes von Vermögensinteressen. Gleichzeitig stellt der strafrechtliche Vermögensschutz kein widerspruchsfreies Systemdar, dessen normative Elemente mit Blick auf die gemeinsame Ordnung so gefügt sind, dass sie einerseits keine Überschneidungen aufweisen und andererseits keine relevanten Lücken lassen.[153]
44
Die Regelung der Vermögensdelikte in den Abschnitten 19 bis 27 folgt keiner stringenten Ordnung. Weder wird eine konsequente Differenzierung nach möglichen Begehungsweisen (Wegnahme, Täuschung, Drohung) durchgehalten, noch bildet sich die verbreitete Einteilung in Eigentums- und allgemeine Vermögensdelikte in Aufbau und Systematik des StGB ab.[154] Obwohl ein sachlicher Grund für die unterschiedliche Behandlung von beweglichen Gegenständen und anderen Vermögenswerten nicht ersichtlich ist, sind Eigentums- und allgemeine Vermögensdelikte in ihren Voraussetzungen und ihrer Reichweite nicht aufeinander abgestimmt. Dieser fehlende Gleichklang der Strafnormenführt zu erheblichen Inkonsistenzen im Schutz vermögenswerter Güter ( Rn. 30). Die bestehenden Wertungswidersprüche – etwa beim vorübergehenden Entzug von Besitz – vermag weder die Rechtsprechung noch die Literatur bislang vollständig aufzulösen.
45
Der strafrechtliche Vermögensschutz wird sich in den kommenden Jahren weiter wandeln müssen, um auf die Risiken einer zunehmend komplexen und global agierenden Wirtschaftreagieren zu können. In seiner Suche nach Antworten auf neue kriminogene Phänomene und Bedrohungen wird das deutsche Vermögensstrafrecht immer häufiger Vorgaben der Europäischen Union und internationaler Konventionen zu beachten haben. Es ist abzusehen, dass diese Einflüsse die Ausrichtung des Vermögensstrafrechts auf den Schutz vermögenssichernder Institutionen und die Pönalisierung bereits abstrakter Vermögensgefährdungen noch verstärken wird.
8. Abschnitt: Schutz des Vermögens› § 28 Der Schutz des Vermögens im deutschen Strafrecht› Ausgewählte Literatur
| Baumann, Jürgen |
Der strafrechtliche Schutz bei den Sicherungsrechten des modernen Wirtschaftsverkehrs, 1956. |
| Baumann, Jürgen |
Über die notwendigen Veränderungen im Bereich des Vermögensschutzes, JZ 1972, 1 ff. |
| Bittmann, Folker |
Quantifizierung des Betrugsschadens und Untreuenachteils im Wege korrigierter ex-post-Betrachtung, NStZ 2013, 73 ff. |
| Bockelmann, Paul |
Zum Begriff des Vermögensschadens beim Betrug, JZ 1952, 461 ff. |
| Börner, René |
Die Zueignungsdogmatik der §§ 242, 246 StGB, 2004. |
| Cramer, Peter |
Grenzen des Vermögensschutzes im Strafrecht, JuS 1966, 472 ff. |
| Fischer, Thomas/Hoven Elisa u.a. |
Dogmatik und Praxis des strafrechtlichen Vermögensschadens, 2015. |
| Kegel, Gerhard |
Vermögensbestand, Vermögensherrschaft, Vermögensschutz, Paderborn, 2008. |
| Kindhäuser, Urs |
Gegenstand und Kriterien der Zueignung beim Diebstahl, FS Geerds, 1995, S. 655 ff. |
| Kühl, Kristian |
Umfang und Grenzen des strafrechtlichen Vermögensschutzes, JuS 1989, 505 ff. |
| Naucke, Wolfgang |
Die Anfänge des wirtschaftlichen Vermögens- und Schadensbegriffs beim Betrug, FS Kargl, 2015, S. 333 ff. |
| Otto, Harro |
Die Struktur des strafrechtlichen Vermögensschutzes, 1970. |
| Otto, Harro |
Rechtsgüterschutz und Fremdheitsbegriff der §§ 242, 246 StGB, FS Beulke, 2015, S. 507 ff. |
| Rönnau, Thomas |
Die Dritt-Zueigung als Merkmal der Zueignungsdelikte, GA 2000, 410 ff. |
| Schmid-Hopmeier, Sabine |
Das Problem der Drittzueignung bei Diebstahl und Unterschlagung, 2000. |
| Schmitz, Roland |
Altes und Neues zum Merkmal der Zueignungsabsicht in § 242 StGB, FS Otto, 2007, S. 759 ff. |
| Schünemann, Bernd |
Zur Quadratur des Kreises in der Dogmatik des Gefährdungsschadens, NStZ 2008, 430 ff. |
| Tiedemann, Klaus |
Wirtschaftsstrafrecht – Einführung und Übersicht, JuS 1989, 689 ff. |
| Zieschang, Frank |
Der Einfluß der Gesamtrechtsordnung auf den Umfang des Vermögensschutzes durch den Betrugstatbestand, FS Hirsch, 1999, S. 831 ff. |
[1]
Hirschberg , Der Vermögensbegriff im Strafrecht, 1934, S. 256; Cramer , Vermögensbegriff und Vermögensschaden im Strafrecht, 1991, S. 23.
[2]
Paulus , D. 47, 2, 1, 3.
[3]
Maurach/Schroeder/Maiwald/Hoyer/Momsen , BT/1, § 41 Rn. 4.
[4]
Cramer , Vermögensbegriff und Vermögensschaden im Strafrecht, 1991, S. 23 f.
[5]
Zur Entstehungsgeschichte hier ausf.: Hirschberg , Der Vermögensbegriff im Strafrecht, 1934, S. 262 ff.
Читать дальше