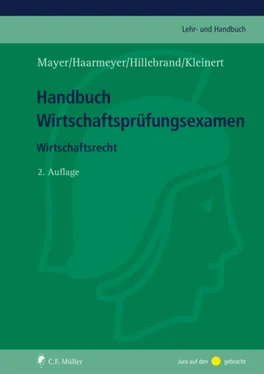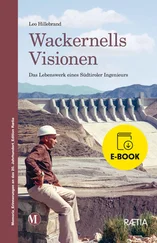807
Der Beseitigungsanspruch schließlich dient nicht der Vermeidung künftiger Verletzungen und hat auch nicht die Aufgabe eines Schadensersatzes, sondern soll eine aus dem früheren Eingriff herrührende Quelle weiterer Störungen beseitigen.[106] Seine wichtigste Erscheinungsform ist der Widerrufsanspruch gegenüber unzutreffenden Tatsachenbehauptungen (insb. im Presserecht).[107]
[1]
Zu den Unterschieden von Bereicherungs- und Rücktrittsrecht: Medicus/Petersen, BR Rn. 660 ff.
[2]
Das Sondervermögenist ein Kriterium zur Abgrenzung der Außen- von einer Innengesellschaft, woraus dann (jedenfalls bei der unternehmenstragenden GbR, bei oHG und KG) die Zuerkennung einer Teilrechtsfähigkeitmit der Anerkennung eigener Rechte und Pflichten folgt.
[3]
Ausnahmen sind Fälle der „ gestörten Gesamtschuld“, bei welcher unterschiedliche Schädiger dem Geschädigten in unterschiedlichem Umfang haften. § 840 passt dafür im Ergebnis nicht, weil sonst der eigentlich privilegiert haftende Schädiger über den Gesamtschuldausgleich u.U. doch gleich den anderen behandelt würde. Jedenfalls im Zusammenhang mit der Haftungsfreistellung eines Arbeitgebersbei Arbeitsunfällen (§ 104 SGB VII) sollen Teilschulden vorliegen, so dass jeder Schädiger nur entsprechend seiner Haftpflicht (nach Umfang und Höhe) belangt werden kann. Vgl. Beispiel bei Medicus/Petersen, BR Rn. 934.
[4]
Allerdings kann § 432 auch aufgrund gesetzlicher Anordnung greifen, vgl. § 1281 im Verhältnis von Pfandgläubiger und Eigentümer bei Zerstörung des Pfands durch Dritte; ebenso nach BGHZ 114, 161, 165 analog im Verhältnis von Vorbehaltsverkäufer und Vorbehaltskäufer bei Zerstörung des Vorbehaltsguts durch Dritte für die jeweiligen Ansprüche aus § 823 Abs. 1.
[5]
Zu besonderen Problemen dabei vgl . Medicus/Petersen, BR Rn. 928–938.
[6]
Die Reichweite dieser Vorschriften (Anwendung auf nichtkaufmännische Unternehmen, Notwendigkeit der Firmenfortführung) und schließlich die rechtliche Qualität des Forderungsübergangs sind umstritten; vgl. dazu K. Schmidt, Handelsrecht § 7 Rn. 63 ff. und vorliegend die Hinweise in Fn. 71 f. zu Rn. 698.
[7]
Einen interessanten Fall des Zusammentreffens von Bürgschaft und Gesamthand zeigen Medicus/Petersen, BR Rn. 942.
[8]
Für den Rücktrittsgrundgenügt es stets, wenn er in der Person eines Gesamtschuldners vorliegt. § 351 ist abdingbar und dann könnte jeder einzelne das Rücktrittsrecht allein und mit Wirkung zugleich für alle anderen ausüben.
[9]
Gleiches gilt für die Minderung nach §§ 441 Abs. 2, 638 Abs. 2; im Fall des Wiederkaufsrechts (vgl. § 461) und v. a. des Vorkaufsrechts (vgl. § 472) kann das Recht zwar auch nur von allen mit Wirkung für alle ausgeübt werden, allerdings besteht jeweils nach S. 2 die Möglichkeit eines Rechtsübergangs auf die Ausübungswilligen allein.
[10]
Hierin liegen oftmals Fälle der „gestörten“ Gesamtschuld begründet; Beispiele bei Medicus/Petersen, BR Rn. 928–938.
[11]
Die Zahlung eines Verpflichteten soll dabei nach RGZ 82, 206, 214–216 (Brand des Fuldaer Doms) ein gesetzliches Schuldverhältnis der GoA zu einem anderen Verpflichteten auch erst schaffen und darüber eine Ausgleichspflicht begründen können (§§ 683, 677, 670). Das wird von Medicus/Petersen, BR Rn. 415, zurecht bestritten, weil es vorliegend erkennbar am Interesse des vermeintlichen Geschäftsherrn fehlen müsste (dessen Schuld gerade nicht, etwa nach § 267, getilgt würde). Auch ein Ausgleich nach §§ 684 S. 1, 818 besteht nicht, weil der Schadensersatzanspruch des Geschäftsherrn nicht etwa durch Restitution des Geschädigten wegfiele; vielmehr muss der Empfänger das Geld schlicht zurückzahlen – vgl. dazu Rn. 640, 648).
[12]
Vgl. Preis, Arbeitsrecht, § 54. Vgl. dazu auch Rn. 208–211.
[13]
Auch aus prozessualen Gründen der Rechtskraft (§ 325 Abs. 1 ZPO), vgl. Beispiel bei Medicus/Petersen, BR Rn. 909.
[14]
Dieses Ziel verfolgt auch die dem Verlustausgleich dienende Sonderregelung des § 255; soweit Gesamtschuld vorliegt, geht § 426 Abs. 2 stets vor. § 255 betrifft nur Fälle nicht gleichstufiger Verpflichtung.
[15]
Beispiele bei Medicus/Petersen, BR Rn. 415 (Brand des Fuldaer Doms) und 942.
[16]
Vgl. K. Schmidt, Gesellschaftsrecht § 47 Abs. 3. Nur die festen Kapitalanteile (meist Kapitalkonto I jedes Gesellschafters; nur dieses meinen die §§ 121, 122, 155 HGB) geben Auskunft über die (relativen) Beteiligungsverhältnisse, während die variablen Konten (z.B. Kapitalkonto II im Hinblick auf § 120 Abs. 2 HGB) lediglich eine Aussage zur (absoluten) Wertdifferenz der jeweiligen Einlagen ausdrücken.
[17]
Die Genehmigung nach § 684 S. 2 macht die Geschäftsführung zur berechtigten; sie wirkt nur im Rahmen der GoA, also im Innenverhältnis zum Geschäftsführer und nicht (automatisch) zugleich im Außenverhältnis gegenüber einem Verfügungsempfänger; erst wenn der Geschäftsherr das Erlangte vom Geschäftsführer herausverlangt (vgl. §§ 684 S. 1, 683 S. 1, 667) gilt dies entsprechend wie bei § 816 Abs. 1, 2 als Genehmigung einer allfälligen Verfügung i.S.d. § 185 Abs. 2 im Verhältnis zum Dritten; vgl. Palandt/ Sprau, § 684 Rn. 2.
[18]
Weitere Beispiele zu irrigen Verpflichtungen aus dem Familienrecht bei Medicus/Petersen, BR Rn. 946 a.E., wobei dort vom Geschäftsführer kein auch eigenes , sondern – von ihm irrig – ein nur eigenes Geschäft angenommen wurde, weshalb dort § 687 Abs. 1 die GoA ausschließt (missverständlich ist a.a.O. die Formulierung „sich selbst für in erster Linie verpflichtet hält“).
[19]
Zu den unterschiedlichen Voraussetzungen vgl. Beispiel bei Medicus/Petersen, BR Rn. 417.
[20]
Palandt/ Sprau, § 687 Rn. 4.
[21]
Vgl. auch Beispiel bei Grunewald, BR § 27 Rn. 8.
[22]
Keinen Fremdgeschäftsführungswillen hat der Bürge; er zahlt auf seine eigene Bürgenschuld. So unter Hinweis auf den unklaren Wortlaut des § 766 S. 3 Medicus/Petersen, BR Rn. 945.
[23]
Palandt/ Sprau (2020) , § 679 Rn. 1.
[24]
Palandt/ Ellenberger (2020) , § 177 Rn. 4; systematisch stellte das eine Durchbrechung von Innen- und Außenverhältnis dar.
[25]
Die Problematik der nicht anerkennenswerten „individuellen Sorglosigkeit im Straßenverkehr“ stellt sich hierbei nicht wie etwa hinsichtlich §§ 690, 708, 1359, 1604; allerdings finden auch diese Haftungsprivilegien ihre Grenze in der groben Fahrlässigkeit (vgl. § 277), so dass entweder hier wie dort zumindest diese Grenze greifen oder gleichermaßen nicht greifen müsste. Diese Konsequenz wurde, soweit ersichtlich, bislang nicht gezogen; vgl. Medicus/Petersen, BR Rn. 930 zur Unbeachtlichkeit von eigenüblicher Sorgfalt im Straßenverkehr bzw. a.a.O. Rn. 433 a.E. zur Anwendbarkeit des § 680 im Straßenverkehr.
[26]
Vgl. das Beispiel bei Medicus/Petersen, BR Rn. 427 ff., 430; umgekehrt kommt einem solchen professionellen Nothelfer das Haftungsprivileg des § 680 nicht zugute, vgl. Palandt/ Sprau (2020), §§ 680 Rn. 1 und 683 Rn. 8.
[27]
A.A., nämlich analoge Anwendung, Medicus/Petersen, BR Rn. 428 a.E. unter Hinweis auf eine h.M.; wie hier Palandt/ Sprau (2020), § 845 Rn. 3.
[28]
Das ist ein Rechtsfolgenverweis, weil die GoA alle Voraussetzungen bereits bestimmt, und anderenfalls Leistungen des Geschäftsführers an den Geschäftsherrn stets wegen § 814 (Kenntnis der Nichtschuld) ausgeschlossen wären – bei der GoA besteht ja gerade keine Pflicht zur Übernahme.
Читать дальше