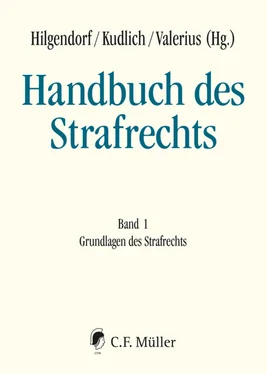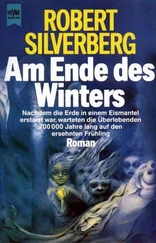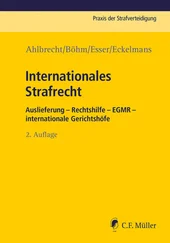91
Nach der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts folgt aus dem Schuldprinzip zwingend, dass die Schuld an eine konkrete Tat anknüpfen muss; die Schuld des Täters ist also „Tatschuld“.[558] Der Schuldgrundsatz steht damit der Lehre vom normativen Tätertypentgegen, die vor allem im nationalsozialistischen Rechtsdenken verhaftet war[559] und in Einzelfällen im geltenden StGB weiterhin aufscheint.[560] Zu Recht hat deshalb eine Expertengruppe vorgeschlagen, das in §§ 211, 212 StGB enthaltene Relikt der normativen Tätertypen („Mörder“, „Totschläger“) zu reformieren.[561] Das verfassungsrechtliche Bedenken an der Lehre vom normativen Tätertyp liegt nämlich vor allem darin, dass sie auf die „Volksanschauung“, wer typischerweise als Unrechtstäter in Betracht kommt, zurückgreift[562] und wegen dieser Unbestimmtheit im Einzelfall zu einer Strafbarkeitserweiterung führen kann. Gewisse Überschneidungen dieser Lehre gibt es mit dem – eindeutig verfassungswidrigen – Konzept eines sog. „Feindstrafrechts“ und dem ebenfalls nicht unproblematischen Ansatz eines „Gesinnungsstrafrechts“.[563] Auch das gegenwärtig diskutierte Unternehmensstrafrecht, wonach Straftaten unter Umständen auch Verbänden und juristischen Personen des Privatrechts zugerechnet werden, reibt sich mit den hergebrachten Anforderungen des Schuldgrundsatzes.[564]
92
Die in Art. 6 Abs. 2 EMRK statuierte Unschuldsvermutung genießt in Deutschland Verfassungsrang, obgleich sie im Grundgesetz nicht ausdrücklich normiert ist. Unter Rückgriff auf die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte[565] erkennt das Bundesverfassungsgericht die Unschuldsvermutung als besondere Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips mit Berührungspunkten zum Fairnessgebot, zum Schuldprinzip und zur Menschenwürdegarantie an.[566] Zugleich verdeutlichen die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, dass die Unschuldsvermutung über das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG), jedenfalls aber über Art. 2 Abs. 1 GG subjektivrechtlich einklagbarist.[567] Die Unschuldsvermutung schützt den Beschuldigten zum einen vor sämtlichen Nachteilen, die einem Schuldspruch oder einer Strafe gleichkommen, denen aber kein prozessförmliches Verfahren zur Schuldfeststellung vorausgegangen ist.[568] Zum anderen verlangt die Unschuldsvermutung des rechtskräftigen Nachweises der Schuld, bevor diese dem Betroffenen im Rechtsverkehr entgegengehalten werden kann.[569] Die Unschuldsvermutung steht ferner in engem Zusammenhang mit dem Grundsatz „in dubio in reo“, wonach der Angeklagte freizusprechen ist, wenn der legale Beweis seiner Schuld nicht erbracht ist.[570]
VI. Nemo tenetur se ipsum accusare
93
Der althergebrachte Grundsatz der Aussagefreiheit des Beschuldigtenund des Verbots des Zwangs zur Selbstbelastung ist zwar in Art. 14 Abs. 3 lit. g IPbpR verankert, findet aber weder im Grundgesetz noch in der Europäischen Menschenrechtskonvention explizite Erwähnung.[571] Dennoch wird der nemo tenetur-Grundsatz als Verfassungsprinzip qualifiziert, das zum einen in engem Zusammenhang mit der Unschuldsvermutung des Art. 6 Abs. 2 EMRK und dem Kernbereich eines fairen Verfahrens i.S.d. Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK steht, zum anderen im Rechtsstaatsprinzip und in der Menschenwürdegarantie, wenigstens aber im allgemeinen Persönlichkeitsrecht wurzelt.[572] Geschützt ist die Freiheit von Zwang, sich durch eigene Aussagen einer Straftat zu bezichtigen oder zu der eigenen Überführung aktiv beizutragen.[573] Der tiefere Grund der verfassungsrechtlichen Garantie der Aussagefreiheit des Beschuldigten ist freilich darin zu sehen, dass jedweder Folter oder unmenschlichen Behandlung zur Gewinnung von selbstbelastenden Aussagen entgegengewirkt werden soll. Deshalb geht der Schutz des nemo tenetur-Prinzips über die bloße Aussagefreiheit des Beschuldigten hinaus und ergreift personell auch Aussageverweigerungsrechte von Zeugen. Während dem Zeugnisverweigerungsrecht nach §§ 52–54 StPO der Gedanke zugrunde liegt, nahen Verwandten und bestimmten Vertrauenspersonen des Beschuldigten den Konflikt zwischen Wahrheitspflicht und anderen grundgesetzlich verbrieften Rechten, etwa dem Recht auf Intim- oder Privatsphäre (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG), zu ersparen,[574] zielt das Aussageverweigerungsrecht nach § 55 StPO allein auf die Wahrung des nemo tenetur-Prinzips.
94
Inhaltlich ist der nemo tenetur-Grundsatz tendenziell weit zu verstehen. So darf das Schweigen des Beschuldigtennicht als belastendes Indiz gegen ihn verwendet werden, wenn er die Einlassung zur Sache vollständig verweigert hat.[575] Anderes gilt allerdings in Fällen des Teilschweigens; insoweit dürfen im Rahmen der Beweiswürdigung nachteilige Schlüsse gezogen werden, da der Kern der Menschenwürde, aus der der Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit folgt, nicht berührt ist.[576] Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sieht das Schweigerecht des Beschuldigten nicht als absolut geschützt an.[577] Er hält aber – ebenso wie inzwischen auch das Bundesverfassungsgericht – den nemo tenetur-Grundsatz dann für verletzt, wenn ein Beschuldigter, obwohl er sich auf sein Schweigerecht berufen hat, unbemerkt einer vernehmungsähnlichen Befragung durch einen verdeckten Ermittler unterzogen wird.[578] Zu weit gehen würde es jedoch, den nemo tenetur-Grundsatz schlechthin auf einen Schutz gegen Täuschung oder List zu erstrecken; erst recht schützt das Verbot nicht gegen heimliche Ermittlungsmaßnahmen.[579] Insoweit ist auch der Einsatz von Lockspitzeln(„agents provocateurs“) als Ermittlungsmaßnahme zur Bekämpfung von schwerer Kriminalität grundsätzlich statthaft.[580] Unter Rückgriff auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte[581] judiziert der zweite Strafsenat des Bundesgerichtshofs jedoch nunmehr, dass aktive Tatverleitungen durch physischen oder psychischen Druck zu einem Verfahrenshindernis[582] und nicht mehr lediglich zur Strafmaßreduzierung führen können.[583]
95
Der strafverfahrensrechtliche Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ ist weder in der Strafprozessordnung noch im Grundgesetz ausdrücklich niedergelegt. Obwohl das Bundesverfassungsgericht diesen Grundsatz seinen Entscheidungen zugrunde legt, hat es dessen verfassungsrechtlichen Rang bislang offengelassen.[584] Da das Prinzip in dubio pro reo letztlich aus einem Zusammentreffen von materiellem Schuldgrundsatz und prozeduraler Unschuldsvermutung folgt und diese beiden Grundsätze jeweils Verfassungsrang genießen, liegt es freilich nahe, auch dem in dubio-Grundsatz gewohnheitsrechtlichen Verfassungsrangzuzusprechen.[585] In der Sache ist der Grundsatz allerdings eng auszulegen. So ist er nicht schon dann verletzt, wenn der Richter hätte zweifeln müssen, sondern nur dann, wenn er verurteilt, obgleich er tatsächlich zweifelt.[586] Eine fehlerhafte Beweisaufnahme oder -würdigung verletzt deshalb nur dann spezifisches Verfassungsrecht, wenn sich das Gericht von rechtsstaatlichen Grundsätzen so weit entfernt hat, dass der rationale Charakter der Entscheidung verlorengeht und sie keine tragfähige Grundlage mehr für die mit einem Schuldspruch einhergehende Strafe sein kann. Der Zweifelssatz bezieht sich außerdem nicht auf einzelne Beweiselemente, sondern erst auf die abschließende Gewinnung der Überzeugung aufgrund der gesamten Beweissituation; er ist also keine Beweis-, sondern eine Entscheidungsregel.[587] Allerdings können bestimmte Geheimhaltungsinteressen der Exekutive im Strafverfahren durchaus in dubio pro reo wirken.[588]
1. Abschnitt: Das Strafrecht im Gefüge der Gesamtrechtsordnung› § 2 Verfassungsrechtliche Vorgaben für das Strafrecht› E. „Strafverfassungsrecht“ und verfassungsgerichtliche Kontrolle einfachgesetzlicher Gewährleistungen
Читать дальше