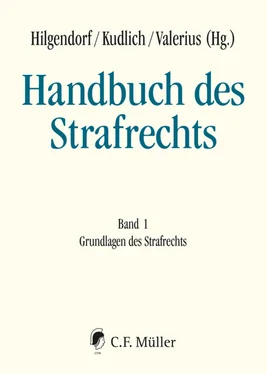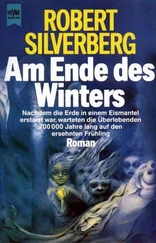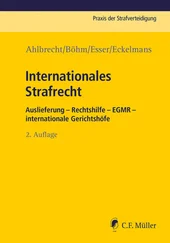59
Das sich aus Art. 103 Abs. 2 GG ergebende Gebot der Gesetzesbestimmtheit gilt nicht nur für den Straftatbestand, sondern auch für Art und Maß der Strafandrohung. Diese muss in einem vom Schuldprinzip geprägten Strafsystem sachangemessen auf den Straftatbestand und das in ihm als strafwürdig bewertete typisierte Unrecht abgestimmt sein.[354] Verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist aber, dass der Gesetzgeber bei der Festlegung der Strafrechtsfolgen auf ein abstraktes Höchstmaß an Präzision verzichtet, wie es mit absoluten Strafen theoretisch zu erreichen wäre, und stattdessen dem Richter die Festlegung einzelner Rechtsfolgen innerhalb gesetzlich festgelegter Strafrahmen überlässt. Im Blick auf die Besonderheiten des Einzelfalls kann nämlich erst der Richter die Angemessenheit der konkret bemessenen Strafe beurteilen.[355] Als Mindestanforderungen verlangt das Bundesverfassungsgericht allerdings, dass das Gesetz die Art der für den jeweiligen Tatbestand in Betracht kommenden Sanktion nennt und die Straftatbestände des Besonderen Teils einen Strafrahmen mit Mindestmaß und Höchstmaß der Strafe aufweisen.[356] In dieses Gebot einbezogen sind alle strafrechtlichen Sanktionen, auch Nebenstrafen und Nebenfolgen, Einziehung und Verfall.[357] Dasselbe gilt für Strafzumessungsregeln, die einen erhöhten Strafrahmen z.B. an das Vorliegen eines „besonders schweren Falls“ knüpfen. Zur Bestimmtheit des materialen Merkmals der „besonderen Schwere“ tragen jedoch nicht nur die vom Gesetzgeber normierten Regelbeispiele, sondern auch die von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien bei.[358] Um Rechtsfolgenbestimmtheit und Schuldprinzip in praktische Konkordanz zu bringen, darf der Strafrahmen nicht zu eng gesteckt sein. Die absolute Strafandrohung der lebenslangen Freiheitsstrafe bei § 211 StGB kann daher im Blick auf das Schuldprinzip in Einzelfällen bedenklich sein.[359]
60
Auch wenn die Fassung eines Gesetzes dem Bestimmtheitsgebot entspricht, kann doch seine Anwendung dagegen verstoßen. Daher richtet sich der Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 103 Abs. 2 GG auch an die rechtsprechende Gewalt.[360] Ihr ist es untersagt, Straftatbestände oder Strafen durch Gewohnheitsrecht oder im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung, insbesondere durch Analogie, zu begründen oder zu verschärfen,[361] nicht aber zu mildern.[362] Der aus der Sicht des Normadressaten zu bestimmende mögliche Wortsinn des Gesetzes markiert aus Gründen der Rechtssicherheit und des Demokratieprinzips die äußerste Grenze für die richterliche Auslegung einer Strafbestimmung. Ausgeschlossen ist deshalb jede Rechtsanwendung, die über den durch den möglichen Wortlaut geprägten Inhalt einer gesetzlichen Sanktionsnorm hinausgeht oder den Gedanken des Gesetzes zur Lückenschließung fortentwickelt.[363] Nicht verwehrt ist den Strafgerichten hingegen eine teleologisch begründete (erweiternde oder reduzierende) Auslegung der Strafbestimmung, soweit die Interpretation noch wortlautkonform erfolgt.[364] Die Grenzen zwischen der erlaubten Interpretation, der verbotenen entgrenzenden Auslegung und der verbotenen Analogie sind freilich fließend.[365] Während eine teleologische Interpretation den Gedanken des Gesetzes klarstellt, wird bei einer entgrenzenden Auslegung der Wortlaut gedehnt, überstrapaziert oder in sein Gegenteil verkehrt.[366] Desgleichen wird bei der verbotenen Analogieder Gedanke des Gesetzes über eine (tatsächliche oder vermeintliche) Lückenschließung weiterentwickelt, also die Identität der Gesetzesnorm zum Nachteil des Täters verlassen.[367] Es ist gerade der Sinn des Analogieverbots, einer teleologischen Argumentation zur Füllung empfundener Strafbarkeitslücken, die auch durch einen Bedeutungswandel des Wortlautes entstehen können, entgegenzuwirken.[368] Bei etwaigen Gesetzeslücken ist es alleinige Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, ob er die Strafbarkeitslücke bestehen lassen oder durch eine neue Regelung schließen will.[369]
3. Rückwirkungsverbot (nulla poena sine lege praevia)
61
Das strafrechtliche Rückwirkungsverbot bedeutet, dass jemand nur aufgrund eines Gesetzes bestraft werden kann, das zur Zeit der Tat schon in Kraft war, dem Täter also bekannt sein konnte.[370] Das Gebot der nulla poena sine lege praevia ist die älteste und schärfste Gewährleistung des Art. 103 Abs. 2 GG; sie dient nicht nur der Rechtssicherheit, sondern fußt letztlich in der Menschenwürde.[371] Deshalb ist das strafrechtliche Rückwirkungsverbot – anders als das allgemeine rechtsstaatliche Rückwirkungsverbot nach Art. 20 Abs. 3 GG – im Regelfall auch keiner Abwägung zugänglich.[372] Lediglich in Fällen schwersten kriminellen Unrechts, vor allem bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit, muss nach der Radbruch ’schen Formel der strikte Vertrauensschutz des Rückwirkungsverbots gegenüber dem Gebot materieller Gerechtigkeit zurücktreten;[373] dies legen auch die sog. „Nürnberg-Klauseln“ des Art. 15 Abs. 2 IPbpR und des Art. 7 Abs. 2 EMRK fest.[374] Ob deshalb die „Mauerschützen“ dem Rückwirkungsverbot nicht unterfielen, wie das Bundesverfassungsgericht dies annahm,[375] kann allerdings bezweifelt werden. Denn anders als die Kriegsverbrecher des nationalsozialistischen Regimes haben die „Mauerschützen“, auch wenn sie sich auf einen menschenrechtswidrigen Rechtfertigungsgrund berufen haben, nicht gegen die von den zivilisierten Völkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätze verstoßen.[376]
62
Art. 103 Abs. 2 GG verbietet dem Gesetzgebersowohl die rückwirkende Strafbegründung als auch die rückwirkende Strafverschärfung.[377] Der Gesetzgeber darf also in der Vergangenheit liegendes Verhalten nicht nachträglich neu mit Strafe bedrohen oder eine bestehende Strafandrohung verschärfen, auch nicht durch Entfallenlassen von positivierten Rechtfertigungsgründen.[378] Eine „Vorwirkung“ von Strafgesetzen, die noch nicht in Kraft getreten sind, mögen sie auch schon verabschiedet sein, lässt Art. 103 Abs. 2 GG ebenfalls nicht zu.[379] Das Rückwirkungsverbot des Art. 103 Abs. 2 GG bezieht sich aber nur auf die materiell-rechtliche Vorschriften des Strafrechts einschließlich der objektiven Strafbarkeitsbedingungen.[380] Formelle Vorschriften über die Verfolgbarkeit oder Vollstreckung werden nicht erfasst; eine Verlängerung oder Aufhebung von Verjährungsfristen ist daher mit Art. 103 Abs. 2 GG vereinbar.[381] Der Bürger kann auch nicht darauf vertrauen, dass das Prozessrecht oder das Gerichtsverfassungsrecht nicht geändert wird, selbst wenn die Änderung bereits anhängige Verfahren betrifft.[382]
63
Auch dem Richter ist es untersagt, eine Strafnorm oder eine Vorschrift des Ordnungswidrigkeitenrechts rückwirkend anzuwenden.[383] Neben der Rechtssicherheit und dem Schutz der Menschenwürde dient das Rückwirkungsverbot insoweit der materiellen Gerechtigkeit der Einzelentscheidung, verhindert es doch, dass ein Urteil aus emotionalen Gründen gefällt wird.[384] Zulässig ist dagegen die Anwendung milderen Rechts als des zur Tatzeit geltenden Rechts,[385] auch wenn das Prinzip der Meistbegünstigung (lex mitior) in § 2 Abs. 3 StGB und in § 4 Abs. 3 OWiG von Verfassungs wegen nicht erforderlich ist.[386] Ebenfalls erlaubt ist die Anwendung eines Gesetzes, das das zum Tatzeitpunkt geltende Strafgesetz ersetzt, wenn altes und neues Gesetz den Unrechtsgehalt der Tat gleich bewerten.[387] Bei dem sog. „Normentausch“ dürfen sogar unterschiedliche Normsetzer in Erscheinung treten, etwa wenn ein Bundesgesetz durch eine EU-Verordnung abgelöst wird.[388]
64
Keine Einigkeit besteht in Bezug auf die Frage, ob das Rückwirkungsverbot auf Änderungen der (gefestigten) Rechtsprechung im Strafrechtzu erstrecken ist. Nach einer Ansicht sollen Rechtsprechungsänderungen nicht unter das Rückwirkungsverbot fallen.[389] Sinnvoller erscheint jedoch eine Differenzierung. Geht es lediglich um eine andere strafrechtliche Bewertung aufgrund einer Veränderung der empirisch feststellbaren Tatsachenbasis, greift das Rückwirkungsverbot nicht.[390] Daher konnte die Promille-Grenze, die zu absoluten Fahruntüchtigkeit i.S.d. §§ 315c Abs. 1 Nr. 1a, 316 StGB führt, zwischen Tatzeit und Zeitpunkt der Verurteilung herabgesetzt werden, ohne gegen Art. 103 Abs. 2 GG zu verstoßen.[391] Anders müssen hingegen Rechtsprechungsänderungen beurteilt werden, die ohne Veränderung der Tatsachenbasis das strafrechtliche Unwerturteil modifizieren. Eine solche Vorgehensweise widerspricht dem Gehalt von Art. 103 Abs. 2 GG, da in diesen Fällen die strafrechtliche Reaktion erst aufgrund der „gesetzesergänzenden“ Rechtsprechung vorhersehbar und berechenbar würde.[392]
Читать дальше