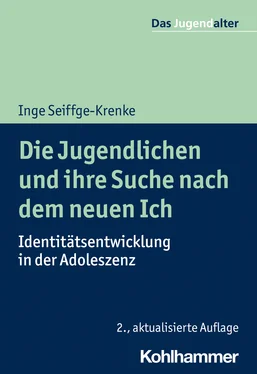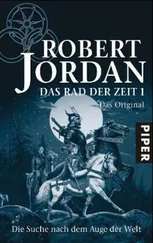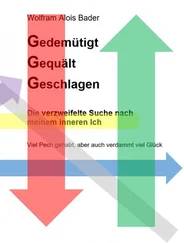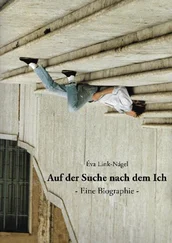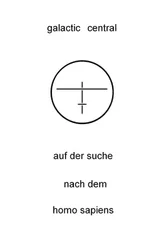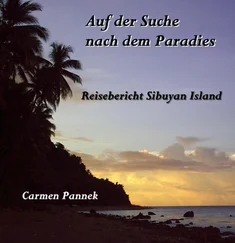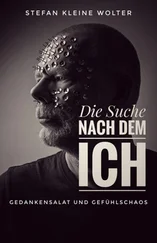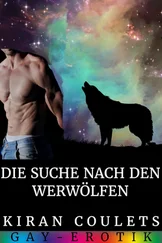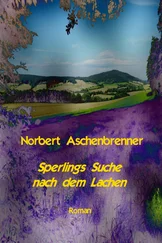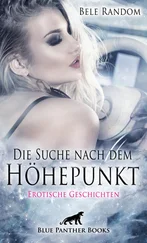Die Arbeiten Eriksons (1959, 1968, 1971) sind insofern innovativ, als er in Absetzung von den frühen psychoanalytischen Ansätzen von Sigmund und Anna Freud das Phänomen der Adoleszenz nicht nur durch eine Zunahme der Triebimpulse begründet, sondern es als eine psychosoziale Notwendigkeit darstellt, die wesentlich zur Integration des Individuums in die Gesellschaft beiträgt. Durch die Postulierung von acht psychosozialen Phasen der Ich-Entwicklung, die sich über den Zeitraum von der Geburt bis ins hohe Alter erstrecken, erweitert er die Auffassung Freuds, für den die Persönlichkeitsentwicklung auf die kindlichen Phasen beschränkt blieb. Auch andere Theoretiker der Psychoanalyse haben einen Schwerpunkt auf die frühe Kindheit gelegt und die Latenz kaum, die Adoleszenz nur unter Triebaspekten konzeptualisiert. Die Adoleszenz, als fünfte von Eriksons Grundphasen, wird durch die Antithese von Identität vs. Identitätsdiffusion charakterisiert und hat, wie erwähnt, eine Schlüsselstellung im Lebenslauf inne. Sie ist die entscheidende Phase, von der aus reife Partnerbeziehungen und später ggfs Elternschaft möglich werden. Tatsächlich würde eine Person mit unreifer Identität bei der Idee der Verschmelzung mit einer anderen Person eher Angst entwickeln. Ein gefestigtes Identitätsgefühl, ein abgegrenztes Körpererleben und Selbstbewusstsein ist notwendig, damit man sich auf intime Beziehungen und Sexualität einlassen kann – so Erikson. Der Zusammenbruch, der Indikator für eine Identitätsdiffusion, ist oftmals zeitlich später zu bemerken, wenn etwa neue Anforderungen (der nächsten Phase) auf den Jugendlichen zukommen, also etwa Berufswahl, Intimität mit einem Partner etc. »Jetzt enthüllt sich die latente Schwäche der Identität« (Erikson, 1971, S. 157). Erikson weist darauf hin, dass Personen mit einer Identitätsdiffusion auch an einer Störung der Leistungsfähigkeit (»Diffusion des Werksinns«, S. 158) leiden.
Zur Erprobung der Identitätsfacetten und der verschiedenen Identifizierungen gehört nach Erikson auch ein spielerisches Ausprobieren, auch oft gewagtes Experimentieren mit Alternativen – real und in der Phantasie. Erikson spricht von einem »Hinauslehnen über Abgründe« (Erikson 1971, S. 145). In diesem Zusammenhang erläutert er auch das Konzept der negativen Identität: »Prahlerische und wütende Widersetzlichkeit gegen alles, was dem jungen Menschen aus der Familie oder der unmittelbaren Umgebung als gute, wünschenswerte Rolle nahegelegt wird« (S. 163). »Jedenfalls«, fährt er fort, »ziehen es manche Jugendliche vor, statt des fortgesetzten Diffusionsgefühls lieber ein Niemand oder ganz und gar schlecht oder gar tot zu sein« (S.168).
Erikson weist darauf hin, dass Jugendliche eines Moratoriums bedürfen, in dem sie all dieses ausprobieren, bevor sie als junge Erwachsene endgültig eine spezialisierte Arbeit aufnehmen können und zur »echten Intimität« fähig sind (Erikson, 1968). Die endgültige Identität, wie sie am Ende der Adoleszenz feststeht, schließt die Auseinandersetzung mit allen bedeutsamen Identifizierungen der Vergangenheit in sich ein, aber sie verändert diese auch und integriert sie mit neuen Facetten zu einem einzigartigen zusammenhängenden Ganzen. Damit nähert sich Erikson sehr stark an Befunde an, die in der Entwicklungspsychologie, u. a. auf der Grundlage umfangreicher Studien, gegenwärtig bekannt sind.
Verschiedentlich ist kritisiert worden, dass die Engfassung der Phasen mit ihrer Normierung an Altersstufen heute, vor allem für postmoderne Gesellschaften, so nicht mehr gültig sei. Auch wenn man die starke Familienorientierung in den Entwicklungsphasen und die nicht umkehrbare Sequenzierung kritisch sehen mag: Die Konzeption von Erikson mit ihrer Annahme der verschiedenen Entwicklungsstufen und ihrem Aufbau aufeinander ist heute noch von Bedeutung. So konnten wir anhand unserer Längsschnittdaten zeigen, dass erst eine reife Identität die Aufnahme qualitativ hochwertiger intimer Partnerbeziehungen möglich macht (Seiffge-Krenke & Beyers, 2016). In unserer Längsschnittstichprobe waren nur Personen, die eine reife, erarbeitete Identität hatten, auch später zu hochintimen, anspruchsvollen Partnerbeziehungen in der Lage. Allerdings war interessant, dass die Bindung eine entscheidende moderierende Funktion hatte. Dies unterstreicht, was auch schon Erikson formuliert hat, dass nämlich frühe Interaktionen und Beziehungen (»Vertrauen«) den Grundstein für die Identitätsentwicklung legen, ein Ansatz, der auch in diesem Buch vertreten wird.
2.2.2 Der Ansatz von Marcia
Ähnlich wie Erikson kombiniert der kanadische Forscher James E. Marcia klinische Praxis mit Entwicklungspsychologie. Bis zu seiner Emeritierung arbeitete er als Professor an der Fraser University in Columbia und teilweise auch an der New York University, Buffalo. Marcia greift Eriksons Theorie auf und elaboriert, die Adoleszenz sei weder durch eine Identitätsfindung noch eine Identitätsdiffusion gekennzeichnet. Diese Phase sei besser dadurch zu verstehen, dass das Individuum in verschiedenen Lebensbereichen (Politik, Sexualität, Religion, Freundschaft etc) exploriert und sich nach der Exploration festlegt. Er entwickelte ein semistrukturiertes Identitätsinterview (Identity Status Interview), das nach diesen beiden Komponenten in den verschiedenen Lebensbereichen fragt und entsprechend ausgewertet werden kann.
Marcia (1966) hat die von Erikson beschriebene »Identitätskrise« in der Adoleszenz also weiter ausdifferenziert. Er unterscheidet vier Identitätszustände (Identitätsstatus genannt), die auf den Dimensionen Exploration (Identitätserkundung) und Commitment (Festlegung auf einen Entwurf) dargestellt werden können. Die eher kognitive Dimension der Exploration ist definiert als das Suchen nach Informationen und Erfahrungen, die relevant für das Verständnis der eigenen Identität sind (z. B. Erkundung der eigenen sexuellen Identität, der Partnerpräferenz, einer politischen Überzeugung, dem persönlichen Interesse für einen bestimmten Beruf u. ä.). Jugendliche explorieren solche Identitätsaspekte, indem sie gezielt nach Informationen suchen, z. B. im Internet oder in Büchern, in Gesprächen mit Betroffenen oder Freunden, den Eltern. Commitment ist dagegen eine eher affektive Dimension und zeigt sich darin, wie sehr sich der Jugendliche in Bezug auf die jeweilige Orientierung verpflichtet oder gebunden fühlt. Auch für Marcia ist also das Jugendalter durch die gezielte Wahl und Ausgestaltung unterschiedlicher Identitätsaspekte gekennzeichnet.
Marcia (1993) kam auf der Grundlage seiner semistrukturierten Interviews zu vier verschiedenen Identitätstatus, die sich durch ein unterschiedliches Mischungsverhältnis der beiden Komponenten Exploration und Commitment ergeben. So ist eine erarbeitete Identity (achieved identity) dadurch gekennzeichnet, dass man erst ausführlich exploriert und sich dann schließlich verbindlich festlegt. Demgegenüber ist foreclosure dadurch gekennzeichnet, dass man sich auf eine bestimmte Identität festlegt, ohne zuvor alternative Optionen erkundet zu haben. Die von ihm beschriebene vier Identitätsstatus (zu nennen wäre noch das Moratorium, wo man nur exploriert, und der diffuse Status, wo man weder exploriert noch sich festlegt) sind später in vielen Studien bestätigt worden ( 
Kap. 3 3 Selbst und Identität in der Kindheit und im jungen Erwachsenenalter und die Zentralität der adoleszenten Identitätsentwicklung Der Begriff der Identität bezieht sich auf die einzigartige Kombination von persönlichen unverwechselbaren Merkmalen eines Individuums, einer einzigartigen Persönlichkeitsstruktur eines Menschen, die aus den Beziehungen zu wichtigen Anderen im Laufe des Lebens entstanden ist. Dieses Empfinden der Kohärenz und Kontinuität im Kontext der sozialen Bezogenheit prägt das Leben und wird Identität genannt (Erikson, 1971). Die Identität enthält viele Komponenten, u. a. die Geschlechtsidentität, die ethnische Identität, die zeitliche Kontinuität des Selbsterlebens, die realistische Wahrnehmung des Selbst über Raum, Zeit und in unterschiedlichen sozialen Bezügen. Man nimmt unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Kontexten wahr und integriert diese in seine Identität (»possible selves«). Dennoch erlebt man sich kohärent über Zeit und Situationen. In diesem Kapitel geht es schwerpunktmäßig um die Zentralität der Identitätsentwicklung in der Adoleszenz, genauer: um die sozial-kognitiven Voraussetzungen dafür, dass diese Entwicklungsperiode so zentral für die weitere Identitätsentwicklung ist, sowie ihre Vorläufer in der Kindheit und die weitere Entwicklung im jungen Erwachsenenalter. Wie genau männliche und weibliche Jugendliche in einer Zeit des körperlichen Wandels, aber auch der Veränderung der Beziehungen diese schwierige Leistung vollbringen, ist dann Gegenstand der Kapitel 4 ( Kap. 4 ) und 5 ( Kap. 5 ).
). Durch diese Differenzierung in ein ganz unterschiedliches Mischungsverhältnis von Exploration und Commitment ist die Forschung sehr vorangetrieben worden, da man nun ganz unterschiedliche Entwicklungstypen verfolgen konnte.
Читать дальше