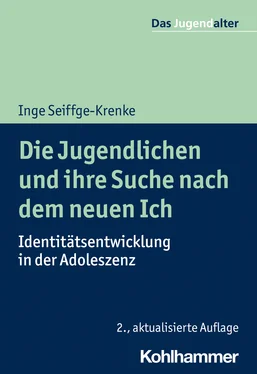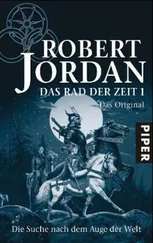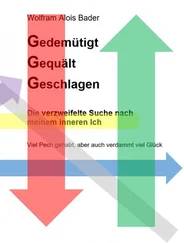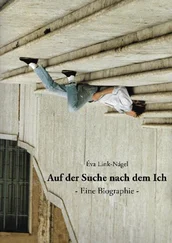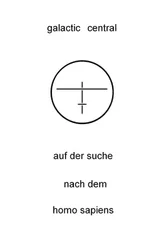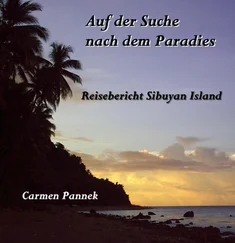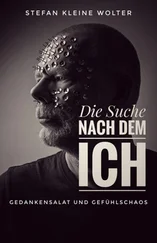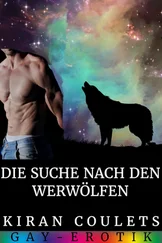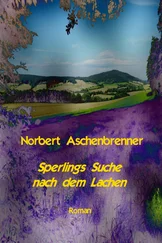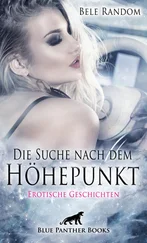Jede der acht Phasen stellt demnach eine Krise dar, mit der das Individuum sich aktiv auseinandersetzten sollte. Die Stufenfolge ist für Erikson unumkehrbar. Die erfolgreiche Bewältigung einer Entwicklungsphase liegt in der Klärung des Konflikts auf dem positiv ausgeprägten Pol. Die vorangegangenen Phasen bilden somit das Fundament für die kommenden Phasen, und angesammelte Erfahrungen werden verwendet, um die Krisen der höheren Lebensalter zu verarbeiten. Dabei wird ein Konflikt nie vollständig gelöst, sondern bleibt ein Leben lang aktuell, war aber auch schon vor dem jeweiligen Stadium als Problematik vorhanden. Das wird besonders deutlich beim Identitätsthema, wie noch zu zeigen sein wird.
Die erste Fassung des Stufenmodells wurde 1950 im Buch Childhood and Society unter »Wachstum und Krisen der gesunden Persönlichkeit« veröffentlicht. Es ist interessant zu sehen, dass es offenkundig nicht ganz einfach ist, die Phase, in der man sich gerade befindet, konzeptuell zu bearbeiten. Erikson ist selbst ein gutes Beispiel dafür, dass man in der Regel nicht den Blick hat für die eigene Entwicklungsphase, sondern dass dies eher durch eine Sicht von außen ermöglicht wird (Seiffge-Krenke, 2012a):
Das siebte Stadium Generativität war ursprünglich gar nicht vorgesehen. Wie ist es entstanden? Erikson war mit seiner Frau auf dem Weg zu einem Vortrag; von Berkeley aus wollte er den Zug nach Los Angeles nehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie drei kleine Kinder. Während der Autofahrt von Berkeley zur Train Station San Francisco amüsierten sie sich darüber, dass Shakespeare, als er die »Seven ages of men« aus »As you like it« beschrieben hat, komplett das Play Stage vergessen hatte, und kamen sich sehr weise vor. »Oh Schreck, er hat sieben Stadien und das Spielstadium vergessen. Haben wir nicht auch sieben Stadien? Was haben wir eigentlich übersehen? Wir sind von Intimität, Stadium 6, zu Integrität im höheren Erwachsenenalter, Stadium 7, gesprungen«. Während der Autofahrt, die Zeit eilte, haben Erikson und seine Frau relativ schnell ein neues, ein siebtes Stadium entwickelt, die Generativität. Interessanterweise sind sie auf das Stadium, in dem sie sich selber befanden, Generativität, erst durch einen Zufall gekommen (Erikson, 1982/1997, S. 3).
Nach Eriksons Tod legte seine Frau Joan eine Weiterentwicklung des Modells vor, in dem sie 9 Phasen postuliert (Erikson, 1982/1997). Die letzte Phase der Gerotranszendenz setzt sich mit dem Altern und dem Tod auseinander. Sie ordnet sie den 80- und 90-Jährigen zu, die sich mit körperlichen Einschränkungen und Verfall, Aufgeben der Autonomie beschäftigen müssen, und nennt sie »a second childhood without play« (Erikson 1982/1997, S. 118). Die Perspektive liegt hier auf dem Kosmischen, Transzendenten, dem Eins-Sein mit der Welt.
2.2 Die klassischen Theorien der Identitätsentwicklung: Erikson und Marcia
Die Entwicklung des Selbst, der Identität als »subjective feeling of sameness and continuity across times and contexts« ist für Erikson (1959, S. 21) eine lebenslange Aufgabe, die sich am Ende des Lebens noch einmal verstärkt stellt. Dennoch hat er damals die entscheidenden Impulse für die Identitätsentwicklung zentral in der Adoleszenz zwischen den Polen Identitätssynthese und Identitätskonfusion angesiedelt und von deren Scheitern eine Beeinträchtigung der folgenden Entwicklungsaufgaben (Intimität und Elternschaft) postuliert. Im Unterschied zu früheren psychoanalytischen Ansätzen, die die Bedeutung der Triebdynamik in der Adoleszenz (S. Freud) und die entsprechenden Abwehrprozesse ins Zentrum der Adoleszentenentwicklung stellten (A. Freud), hat er den psychoanalytischen Raum sehr erweitert. Erikson hat eine Konzeption vorgelegt, in der er die individuelle Entwicklung des Einzelnen und gesellschaftliche Anforderungen, aber auch eigene Kompetenzen einbezieht, eine Idee, die später von Havighurst (1956) in seinem Konzept der altersspezifischen Entwicklungsaufgaben aufgegriffen wird: Es gibt für jede Entwicklungsphase typische Aufgaben des Individuums, die von der Gesellschaft an es herangetragen werden und die es kompetent realisieren, bewältigen muss.
2.2.1 Eriksons Konzept der Identitätsentwicklung im Jugendalter
Das Jugendalter wurde erstmals von Erikson (1968) als eine Phase beschrieben, die für den lebenslangen Prozess der Identitätsentwicklung von herausragender Bedeutung ist. In seiner Theorie der psychosozialen Entwicklung nahm er an, dass acht Themen lebenslang identitätsrelevant sind, von denen jeweils eines altersabhängig besonders drängend und krisenhaft ist. Die aktive Auseinandersetzung mit der jeweiligen lebensphasentypischen Krise ist dabei für die Bewältigung der nachfolgenden Krise hilfreich. Sein Modell ist also eine Stufenfolge von aufeinander aufbauenden Entwicklungsschritten mit spezifischen Herausforderungen, die jeweils gelöst werden müssen. Obwohl er annahm, dass der generelle Zeitplan des Durchlaufens der phasenspezifischen Krisen stark an Bedingungen der biologischen Reife geknüpft ist, betonte er die Bedeutung von Kultur und sozialer Umwelt für ihre Lösung.
Die Krise, die nach Erikson das Jugendalter charakterisiert, war zwischen den Polen Identitätssynthese (d. h. der Integration von früheren Identitätsaspekten und Identifikationen aus der Kindheit) und Identitätskonfusion (der Unfähigkeit, das Ganze zu einer kohärenten Identität zu integrieren) angesiedelt. Sie besteht in der Herausforderung, die eigene Identität zu definieren. Ihr wird von ihm die größte Bedeutung von allen zu bewältigenden Krisen beigemessen. Sie ist dadurch charakterisiert, dass der junge Mensch das, was er bisher von den Eltern unhinterfragt übernommen hat, z. B. politische, religiöse oder sexuelle Orientierung, in Zweifel zieht. Idealerweise wird eine möglicherweise sich einstellende Identitätsdiffusion aufgehoben, in dem der Jugendliche sich mit verschiedenen alternativen Identitätsformen auseinandersetzt, um sich dann aktiv und autonom für eine Identitätsform zu entscheiden.
»Ab der Pubertät werden alle Identifizierungen und Sicherungen, auf die man sich bisher verlassen konnte, in Frage gestellt« (Erikson, 1971, S. 106). Er unterstreicht, dass die Identitätsentwicklung im Jugendalter nicht einfach die Summe der Kindheitsidentifikationen darstellt, sondern ein Integrationsprozess einsetzt von alten und neuen Identifikationen und Fragmenten, wobei die Identifizierungen mit den Eltern überprüft und neue Identifizierungen mit anderen (Erwachsenen, Freunden, romantischen Partnern) entwickelt werden. Das Gefühl der Ich-Identität ist also eine Integrationsleistung, bei der Einheitlichkeit und Kontinuität angestrebt wird. Dieser Prozess ist krisenreich und gefährlich, deshalb gab es schon zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften institutionalisierte psychosoziale Schonzeiten oder Aufschübe, in denen junge Menschen die Möglichkeit der Selbstfindung ausprobieren konnten. Wie in Kapitel 3 ( 
Kap. 3 3 Selbst und Identität in der Kindheit und im jungen Erwachsenenalter und die Zentralität der adoleszenten Identitätsentwicklung Der Begriff der Identität bezieht sich auf die einzigartige Kombination von persönlichen unverwechselbaren Merkmalen eines Individuums, einer einzigartigen Persönlichkeitsstruktur eines Menschen, die aus den Beziehungen zu wichtigen Anderen im Laufe des Lebens entstanden ist. Dieses Empfinden der Kohärenz und Kontinuität im Kontext der sozialen Bezogenheit prägt das Leben und wird Identität genannt (Erikson, 1971). Die Identität enthält viele Komponenten, u. a. die Geschlechtsidentität, die ethnische Identität, die zeitliche Kontinuität des Selbsterlebens, die realistische Wahrnehmung des Selbst über Raum, Zeit und in unterschiedlichen sozialen Bezügen. Man nimmt unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Kontexten wahr und integriert diese in seine Identität (»possible selves«). Dennoch erlebt man sich kohärent über Zeit und Situationen. In diesem Kapitel geht es schwerpunktmäßig um die Zentralität der Identitätsentwicklung in der Adoleszenz, genauer: um die sozial-kognitiven Voraussetzungen dafür, dass diese Entwicklungsperiode so zentral für die weitere Identitätsentwicklung ist, sowie ihre Vorläufer in der Kindheit und die weitere Entwicklung im jungen Erwachsenenalter. Wie genau männliche und weibliche Jugendliche in einer Zeit des körperlichen Wandels, aber auch der Veränderung der Beziehungen diese schwierige Leistung vollbringen, ist dann Gegenstand der Kapitel 4 ( Kap. 4 ) und 5 ( Kap. 5 ).
) und 9 ( 
Kap. 9
) ausgeführt, ist diese »Schonfrist« inzwischen besonders ausgedehnt worden. Erikson verweist in diesem Zusammenhang auf Arthur Millers »Tod eines Handlungsreisenden« (1949), wo einer der Söhne (Biff) sagt: »I cannot get hold of my life« – »Ich kann es einfach nicht zu fassen kriegen, ich kann mein Leben nirgends festhalten.« Wir werden noch auf die neue Entwicklungsphase des »emerging adulthood« eingehen, wo der Aufschub besonders deutlich ist. Es gab also auch schon vor vielen Jahrzehnten junge Leute, die die integrative Leistung nicht schafften.
Читать дальше