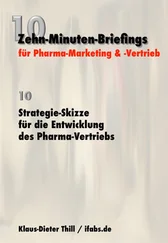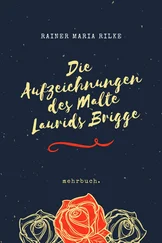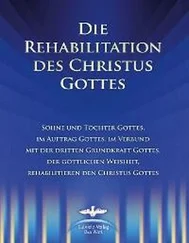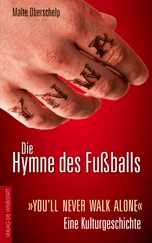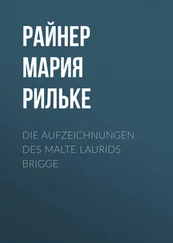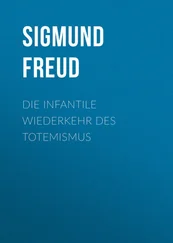Im Unterschied zu dieser perfektionsorientierten Sicht nimmt der amerikanische Kultursoziologe Richard Sennett in seiner Studie zum »Handwerk« konkrete Praktiken in den Blick und stellt Überlegungen zu einer Didaktik der Übung an (vgl. Sennett 2008). Er untersucht darin vor allem vormoderne (kunst-)handwerkliche Praxen wie Goldschmieden, Geigenbau, Glasblasen, Kochkunst, aber auch Instrumentalspiel. Seine Ausführungen bieten eine Fülle von wichtigen Einsichten zur Didaktik der Übung am Beispiel der menschlichen Hand und des Handwerks. Da Sennet sich in seiner Studie vornehmlich auf vormoderne (kunst-)handwerkliche Traditionen bezieht, favorisiert er auch imitatorische und mimetische Formen der Übung: Der Lehrling macht es dem Meister nach und gleich. Komplexere geistige und mentale Übungen oder auch komplexere didaktische Praktiken der Übung kommen nicht in den Blick (  Kap. 7.3).
Kap. 7.3).
Eine ganz andere Perspektive auf das Üben nimmt die ältere Hirnforschung ein. Hier werden wiederholende Übungen als erfahrungsabhängige und erfahrungsbildende Bahnung von Nervenzellen im »selbstreferentiellen System« Gehirn thematisiert, deren Vernetzung motorisches, volitionales und emotionales Handeln prädisponiert (Roth 2003, S. 154 ff., S. 462 ff., S. 480 ff.). Damit kann ein Zusammenhang zwischen Erfahrung und Reifung empirisch belegt werden. Übung wird hier als Bahnung von Nervenzellen verstanden, mit der diese angeregt und durch weiteren Gebrauch verstärkt wird (»neurons that fire together wire together«) (vgl. Baars/Gage 2010, S. 83). Ihre Position kann im Gehirn mittels bildgebender Verfahren lokalisiert und ihre Verschaltung dargestellt werden. Um Reaktionen, Bewegungen und Handlungen erklären zu können, greift die Hirnforschung auf eine kognitionstheoretische, dualistische Modellierung des Gedächtnisses zurück. Sie unterscheidet zwischen deklarativem und prozeduralem Gedächtnis, wobei hiermit zugleich deklaratives und prozedurales Wissen gemeint ist (vgl. Anderson 2001). Damit wird das ursprünglich angenommene und diagnostizierte Kontinuum komplexer Vernetzungen von Wahrnehmen, Fühlen, Handeln (Prinzip des common coding) in eine Anzahl zeitlich aufeinanderfolgender Repräsentationen und Operationen aufgespalten. In der Kontinuität sukzessiver Operationen erscheint Übung wiederum als sekundäre Lernform. Temporale Differenzen und negative Erfahrungen können damit nicht eingeholt werden ( 
Kap. 4.3
). Aktuelle neurophänomenologische Zugänge versuchen unter dem Titel Embodiment die Einseitigkeiten und die damit verbundenen methodologischen und epistemologischen Probleme der Neurophysiologie und der Kognitionswissenschaften auf ein neues, »verkörpertes« Fundament zu stellen. Im Anschluss an Varela (Varela et al. 2016) und Merleau-Ponty (1974) soll deutlich werden, dass Kognition im Körperlichen und Leiblichen verankert ist (Fuchs 2009; ausführlicher  Kap. 6.4).
Kap. 6.4).
Der amerikanische Psychologe Karl Anders Ericsson hat das Konzept der deliberate practice (der zielgerichteten Übung) entwickelt, mit dem außergewöhnliche Leistungen von Experten wie Schachgroßmeisterinnen und Schachgroßmeistern, Violinistinnen und Violinisten, Klaviervirtuosinnen und Klaviervirtuosen und Sportlerinnen und Sportlern empirisch untersucht und auf gezieltes Üben zurückgeführt werden können (vgl. Ericsson et al. 1993). Als Experte gilt, wer dauerhaft in einem Tätigkeitsfeld herausragende Leistungen bringt. Gezieltes Üben ist eine im höchsten Maße anstrengende Tätigkeit, die keinen Spaß macht. Um damit Leistungsverbesserung zu erreichen, müssen typische Rahmenbedingungen und Ressourcen wie Instrumente, Lehrerinnen und Lehrer und soziales Milieu in einer klar definierten Domäne vorhanden sein, und die übende Person muss motiviert sein, ihre Leistung steigern zu wollen. Die Untersuchungen zeigen, dass im Alter von 20 Jahren die besten Experten ungefähr 10 Jahre insgesamt etwa 10.000 Stunden geübt haben, wobei sich die täglichen vier Stunden gezielter Übung mit Ruhezeiten abwechselten. Gezielte Übung ist daher weitaus bedeutsamer für Erfolg und Leistung als natürliche Begabung. Der qualitative Unterschied zwischen guten und weniger guten Experten eines bestimmten Übungsfeldes (Domäne) wird ebenfalls mit der Theorie kognitiver Repräsentationen und einer modifizierten Form der Speicherung im deklarativen Gedächtnis sowie deren »Verwendung« im prozessualen Gedächtnis erklärt. Allerdings werden auch hier Fehler, Scheitern, Mittelmaß und Normalbiographie ausgeblendet, ebenso wie gesellschaftliche, soziale und individuelle Kontexte, sofern sie nicht affirmativ das Ziel und die Norm der Perfektionierung bestätigen (vgl. Brinkmann 2012, S. 73–80).
Die Erkenntnisse der Expertiseforschung sind für die erziehungswissenschaftliche Professions- und Kompetenzforschung von großer Bedeutung. Der Kompetenzbegriff der Bildungsforschung ist in wesentlichen Teilen der Expertiseforschung entnommen. Nach Weinert und Klieme lässt sich der »dort verwendete Kompetenzbegriff (…) hervorragend auf den schulischen Bereich übertragen« (Klieme 2003, S. 72 f.) und für psychometrische Verfahren der Leistungsmessung nutzen. Das »funktionalistische« Kompetenzmodell, das sowohl PISA als auch den Bildungsstandards der KMK zugrunde liegt, hat den Anspruch, »die Verbindung zwischen Wissen und Können« (ebd.) herzustellen. Weinert fokussiert das Konzept der kognitiven Kompetenzen auf einen begrenzten Bereich von Wissen, Fertigkeiten, Metawissen und fächerübergreifendem Wissen. Dieses wird als Handlungs- bzw. Problemlösekompetenz gefasst. Der Übergang vom Wissen zum Können bzw. die Performanz von Kompetenz wird wiederum, wie in der Kognitionspsychologie und der Hirnforschung, als Prozeduralisierung von kognitiv gespeichertem, deklarativem Wissen bestimmt.
Im Zuge kognitivistischer und konstruktivistischer Theorien werden seit einiger Zeit Hoffnungen auf »elaboriertes Üben« geweckt. Es ist von einer »Wiederkehr des Übens« (Duncker 2008, S. 224) und von »intelligentem Üben« (Meyer 2004, Gudjons 2006) die Rede. In den Bildungsstandards der Fächer Mathematik, Französisch und Englisch wird der hohe Stellenwert des Übens gemäß dem konstruktivistischen Theorem der Selbstregulation als reflektierendes, flexibilisierendes und vernetzendes Üben gefasst. »Lernerorientierte Aufgaben« in authentischen Sprechsituationen in mathematischen Modellierungsaufgaben sollen eine Abkehr vom alten, repetitiven Päckchenrechnen bringen und Eigenaktivität und Eigenverantwortung der Lernerinnen und Lerner sicherstellen. Auch in der Fremdsprachendidaktik sollen nach dem task based approach to language learning reflexive Aufgaben einen übenden Zugang ermöglichen. In authentischen, lebensweltlich orientierten Sprechsituationen soll sich das an der Sprachpraxis orientierte Fremdsprachenlernen vom »alten« grammatikbasierten Unterricht abgrenzen. Übungen spielen auch hier eine zentrale Rolle (vgl. Brinkmann 2020c, 2014a;  Kap. 7).
Kap. 7).
»Intelligentes Üben« (Leuders 2005) wird auch im Qualitätsdiskurs im Zusammenhang mit dem Konzept der kognitiven Aktivierung (Bohl 2012) für erfolgreichen und guten Unterricht gefordert, gemessen und evaluiert (Helmke 2007). Die Merkmalslisten für »guten Unterricht« von Meyer und Helmke haben einen überfachlichen Anspruch. Sie entstammen der quantitativen empirischen Forschung, die auf psychometrischen, experimentellen und statistischen Testverfahren und der kognitiven Kompetenztheorie aufbaut und sich v. a. auf Forschungen aus dem Bereich der mathematischen literacy (Grundbildung) stützen. Allerdings muss eingestanden werden, dass eine kognitive Aktivierung im Fach Kunst anders als im Fach Französisch oder Sachkunde erfahren wird. Zudem ist fraglich, ob für den Erwerb von praktischen Fertigkeiten, individuellen Haltungen wie Gelassenheit und Gerechtigkeit und sozialen Fähigkeiten nur Kognition als Paradigma ausreicht. Implizites Wissen, sozial erworbene Habitualisierungen und körperlich-leibliche Schematismen sind ebenso im Üben wirksam und entziehen sich einem ausschließlich kognitiven und expliziten Zugang.
Читать дальше
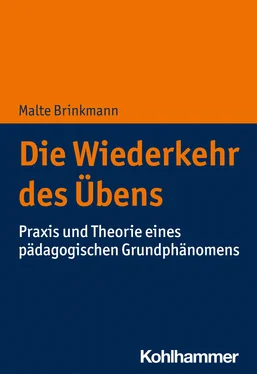
 Kap. 7.3).
Kap. 7.3).