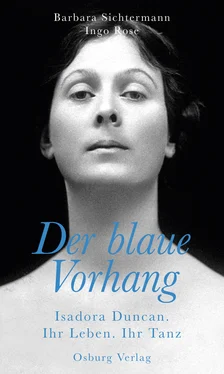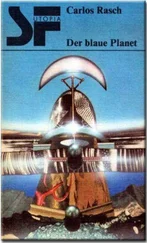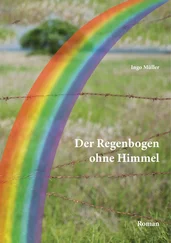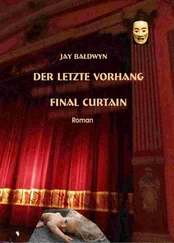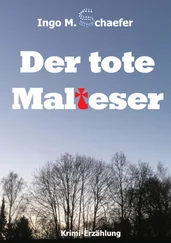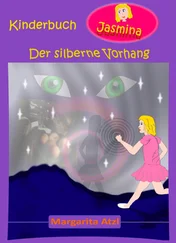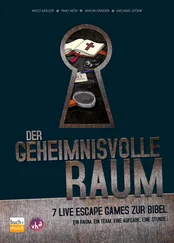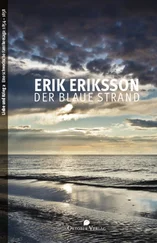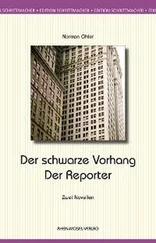1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 Er sagte: »Ich verstehe Sie gut, Isadora. Oscar Beregi ist ein großartiger Schauspieler und ein umwerfend schöner Mann. Wer könnte ihm widerstehen? Wäre ich eine Frau …«
Isadora putzte sich die Nase. »Schon gut, Alexander. Ich danke Ihnen für Ihre Sympathie. Aber was soll ich tun? Ich bin hin- und hergerissen. Oscar, die Bühne, der Mann, die Kunst –«
»Natürlich, das ist ein Konflikt. Aber ich denke, verzeihen Sie, auch ans Geschäft. Wir können uns noch fünf, sechs Tage ohne Auftritt leisten, dann wird es finanziell eng. Was halten Sie von München? Ich hätte da Verbindungen.« Isadora maß in Gedanken den Abstand von Budapest nach München und nickte traurig.
Ihren Trennungsschmerz verwandelte sie in Kunst. Sie ersann eine Variante der Geschichte von Iphigenie, einen Tanz, der den Abschied vom Leben am Altar des Todes darstellt. Für eine endgültige Genesung begab sie sich mit Elizabeth ins mondäne Seebad Abbazia (Opatija) auf der Halbinsel Istrien, den ersten Kurort an der österreichischen Adriaküste. Die beiden Frauen fuhren die schmale Küstenstraße auf der Suche nach einer Unterkunft rauf und runter und erregten so die Aufmerksamkeit der Leute in dem kleinen Ort, auch die des Erzherzogs Ludwig Viktor, des jüngsten Bruders vom österreichischen Kaiser. Ludwig Viktor, ein bekennender Uranier, lud die beiden kurzerhand in seine Villa im Garten des Hotels Stephanie ein, dort konnten sie wohnen. Das wiederum löste eine nicht geringe Irritation in den aristokratischen Kreisen des Kurortes aus, die sich neugierig an die Tänzerinnen wandten – doch nicht etwa aus Interesse an der Kunst, nein, die meisten wollten herausfinden, in welchem Verhältnis die Frauen zu Ludwig Viktor standen. Die Schwestern ließen es sich gut gehen, speisten ausgiebig und gingen schwimmen, natürlich nicht in dieser Reihenfolge. »Damals führte ich ein Badekostüm ein, das bald sehr beliebt wurde, eine leichte blaue Tunika aus hauchfeinem Crêpe de Chine, mit tiefem Nackenausschnitt, dünnen Trägern, einem Rock, der eben die Knie bedeckte, die Beine nackt. Es war noch üblich, vollständig in Schwarz gekleidet mit knöchellangen Hosen und Schuhen ins Wasser zu gehen. Man kann sich vorstellen, was für ein Aufsehen ich erregte. Der Erzherzog wandelte stets mit einem Opernglas bewehrt die Promenade entlang und beobachtete uns. Gut hörbar murmelte er: ›Ach, wie schön ist diese Duncan. Ach, wie wunderschön! Diese Frühlingszeit ist nicht so schön wie sie.‹«
Jener paradiesische Flecken Erde inspirierte Isadora Duncan zu einer wiederkehrenden Stilfigur ihrer Kunst. Denn hier in dem gemäßigten Klima wuchsen Palmen direkt vor ihrem Fenster, sie konnte sie oft beobachten.
»Ich bemerkte, wie die Palmblätter sich in der Morgenbrise wiegten und kreierte ähnliche Bewegungen für meinen Tanz, etwa das Flattern der Arme, Hände und Finger. Viele meiner Nachahmerinnen haben das zu kopieren versucht, ohne dass sie überzeugen konnten. Denn sie wussten nichts von der Quelle dieser Bewegungen, dem kontemplativen Zittern der Palme, und konnten sie daher nicht innerlich empfangen, bevor sie äußerlich Gestalt annahmen.«
Grosz kabelte, er habe da eine Anfrage: »Münchner Künstlerhaus. Stop. Was meinen Sie?« Von diesem Etablissement hatte Isadora gehört, es war erst vor wenigen Jahren unter dem Motto Das Haus soll allen Künstlern Münchens ein Sammelplatz sein für Frohsinn, Rat und ernste Tat eröffnet worden – ein opulent ausgestatteter Neorenaissance-Bau, der wegen seiner ungewöhnlichen Fassade ins Auge fiel. »Dort traf sich täglich ein Kreis von Künstlern um die Meister Kaulbach, Lenbach und von Stuck, um das gute Münchner Bier zu trinken und über Philosophie und Kunst zu debattieren.« Die Duncans und Grosz fuhren im November 1902 nach München, und Isadora trat im Künstlerhaus auf. Aber das war nicht selbstverständlich, es gab im Vorfeld Widerstände gegen den Auftritt einer Tänzerin, insbesondere von Franz von Stuck. Der Jugendstilmaler fand eine leicht bekleidete, barfuß tanzende Frau unpassend in diesem Tempel der Kunst. Dabei hatte sich der Mann über Jahre mit dem Thema Tanz in Paar- und Reigentänzen sowie einzeln tanzender Frauen intensiv beschäftigt. Also glaubte er kompetent zu sein und fürchtete, Isadora würde ihn enttäuschen oder, schlimmer noch, den Kunsttempel mit vulgärem Exhibitionismus entweihen. Wenn Isadora solchen Vorbehalten begegnete, trat sie meist einen Schritt auf die Menschen zu. Eines Morgens besuchte sie also den Künstler in seiner von ihm selbst errichteten großartigen Villa in der Prinzregentenstraße, zog sich um, tanzte für ihn in ihrer Tunika und setzte ihm anschließend über Stunden »die Heiligkeit meiner Mission – die Wiedergeburt der Religion mit den Mitteln des Tanzes« auseinander. »Später erzählte von Stuck, wie er mir anvertraute, seinen Freunden gern, dass er selten in seinem Leben so überrascht gewesen sei. Es habe sich für ihn angefühlt, als sei eine Waldnymphe vom Olymp herab in sein Atelier gestiegen. Natürlich gab er seine Zustimmung.«
Isadora hatte einen Riecher für die richtigen Orte ihrer Auftritte. So tanzte sie auch im Kaim-Saal in der Maxvorstadt, wo Arthur Schnitzlers Reigen uraufgeführt wurde und die weltweit erste Eurythmie-Vorführung stattfand. Und sie sorgte auch hier für eine Sensation. »Der Erfolg war unglaublich. Besonders die Studenten gebärdeten sich wie verrückt. Nacht für Nacht spannten sie die Pferde meines Wagens aus und zogen mich durch die Straßen. Dazu schmetterten sie ihre Studentenlieder und liefen mit Fackeln neben meiner Kutsche her. Oft standen ganze Gruppen stundenlang vor meinem Hotelfenster und sangen, bis ich ihnen Blumen und Taschentücher zuwarf, um die sie sich dann balgten, weil sie sie auf ihre Kappen heften wollten.«
Isadora ließ sich von diesem Enthusiasmus anstecken, in einem Studentencafé tanzte sie tatsächlich auf den Tischen, was in der Satire-Zeitschrift Simplicissimus Erwähnung fand. Sie schrieb in ihren Memoiren: »Die jungen Leute tanzten die ganze Nacht, ein wiederkehrender Refrain war ›Isadora, Isadora, ach, wie schön das Leben ist‹. Obgleich einige nüchterne Bürger der Stadt schockiert reagierten, blieb es doch ein unschuldiger Spaß – auch wenn mir Kleid und Schal regelrecht zerrissen wurden.«
Eines Abends entdeckte Isadora bei einem Auftritt im Künstlerhaus in der ersten Reihe das Profil eines Mannes, das ihr bekannt vorkam. Diese markante Nase, die hohe Stirn und die auffälligen Augenbrauen hatte sie schon irgendwo gesehen. Es war der seinem Vater sehr ähnliche Siegfried Wagner, der da begeistert applaudierte. Isadora war begierig zu hören, was der Sohn des hochverehrten Komponisten zu erzählen hatte. Siegfried Wagner war bei Engelbert Humperdinck in die Lehre gegangen, der bald in Berlin ein wichtiger Unterstützer Isadoras werden sollte. Jetzt kam Wagner mit einem Liliengebinde zu ihr in die Garderobe und sagte:
»Miss Duncan, was Sie auf der Bühne machen, davon könnten wir auch in Bayreuth eine Menge lernen. Wären Sie bereit, für unsere Festspiele zu arbeiten?«
Isadora lächelte erst einmal nur, wie sie es meistens tat, wenn sie Zeit brauchte, um einen Entschluss zu fassen. Dann sagte sie:
»Es wäre mir eine große Ehre, bei Ihnen im Festspielhaus aufzutreten. Aber – ich kann leider nicht singen.« Beide lachten, sie verlegen, er höflich. Dann sagte er:
»Sie wissen, dass Tanzeinlagen in den Opern meines Vaters eine wichtige Funktion erfüllen?«
»Tanzeinlagen –« wiederholte Isadora gedehnt, »Das eben biete ich nicht.« Und sie erklärte Siegfried Wagner das Niveau und den Anspruch ihrer Kunst, so gut es in der Eile ging.
»Ich verstehe«, sagte Wagner, »und pflichte Ihnen bei. Es geht um mehr als um Einlagen. Beziehungsweise: Es geht um etwas ganz anderes. Um einen Appell an die Gottheit. Um eine Anrufung. Um Erhabenheit. Darum geht es uns auf dem Grünen Hügel auch. Ich bin sicher, wir werden uns einig. Ich werde meine Mutter bitten, sich an Sie zu wenden.«
Читать дальше