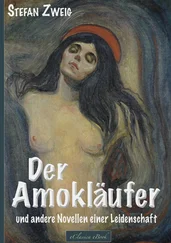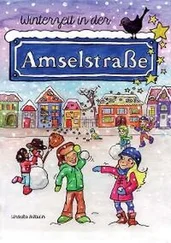Nach dem Essen verließ Pierre das Fort und half den anderen beim Aufräumen. Sie suchten nach toten Indianern, doch die Indianer hatten ihre Toten geborgen und mitgenommen. Pierre fand seine Biberfellmütze und setzte sie mit einem Seufzen auf. Die Stelle, wo seine Haare versengt worden waren, juckte leicht, und er kratzte sich. Dann kehrte er ins Fort zurück und versuchte die Flecken zu entfernen. Er war da ein bisschen heikel … es war nicht sein eigenes Blut, und er ekelte sich davor. Bei Tieren machte es ihm nichts aus … aber bei Menschen. Geduldig weichte er die blutbefleckten Stellen seines Mantels in Wasser ein und rubbelte das Blut heraus. Es ging ganz gut. Bis auf ein paar leicht bräunliche Flecken war nichts mehr zu sehen. Pierre hängte den Mantel in der Nähe des Feuers auf und ging dann in den hinteren Raum, wo mehrere Betten standen. Auch hier stand ein kleiner Ofen, der den Raum notdürftig wärmte. Aber es war besser als nichts. An den Wänden glitzerten die Tautropfen, die zeigten, dass der Frost sogar die Innenwand erreicht hatte. Der Raum war dunkel und rauchig, und es roch nach feuchtem Leder und den Ausdünstungen der Männer. Wer hier lebte, hatte keine Ansprüche. Die anderen Hütten standen im Moment leer, weil es einfacher war, nur das Haupthaus zu beheizen. Manche Trapper blieben ohnehin in der Wildnis bei ihren kleinen Hütten oder Zelten, weil sie ihre Fallen nicht alleine lassen wollten. Manche waren so weit weg, dass es zu viel Zeit kostete, jeden Abend ins Fort zurückzukehren. Pierre warf sich auf eine Pritsche und dachte an die armen Teufel, die jetzt vielleicht allein in der Wildnis saßen und keine Ahnung hatten, dass kriegerische Pekuni unterwegs waren.
Neben ihm lag Arnel, der sich auf den Ellbogen stützte. „So ein Mist! Was machen wir, wenn noch mehr solche kriegerische Injuns hier auftauchen?“ Seine braunen Augen richteten sich sorgenvoll auf seinen Freund. Er hatte immer noch die schlaksige Figur eines Jugendlichen und wirkte naiv und unerfahren. Er strich sich eine Strähne seines schwarzen Haars, das bis auf seine Schultern fiel, nach hinten.
Pierre runzelte die Stirn. „Keine Ahnung! Als Lewis und Clark hier unterwegs waren, dachten sie eigentlich, dass man hier friedlich Handel treiben kann. Ich weiß auch nicht, warum diese Pekuni so aufgebracht sind. Jedenfalls möchte ich ihnen nicht lebend in die Hände fallen.“
„Oje!“ Arnel schluckte schwer. Er war ein Abenteurer, ein Tausendsassa, der schon mit vierzehn Jahren von seinem Zuhause ausgebüxt war. Hier bei den Trappern hatte er gefunden, was er schon immer gesucht hatte: eine freie Gemeinschaft, die keine Fragen stellte, welche Herkunft jemand hatte. Arnel war ein Halbblut, und in zivilisierteren Gegenden war das ein Makel. Seine Mutter war eine Dakota-Frau der Yankton gewesen. Sie war früh gestorben, und so war Arnel mit seinem Vater, einem trunksüchtigen Händler, unterwegs gewesen, der den Jungen hart arbeiten ließ. Irgendwann hatte Arnel die Beschimpfungen und Misshandlungen nicht mehr ausgehalten und war bei Nacht und Nebel verschwunden. Trotz seiner Jugend war er bereits ein geschickter Jäger, und so war er von den Pelzhändlern aufgenommen worden. Pierre hatte ihn unter seine Fittiche genommen, wobei die Beziehung auch für ihn Vorteile hatte: Durch Arnel sprach er inzwischen ein ganz passables Englisch.
Mato-wea
Dorf der Mandan am Knife-Fluss
Mato-wea, was Bärenfrau bedeutete, stand außerhalb der Palisaden ihres Dorfes und besuchte den heiligen Schädelkreis ihrer Vorfahren. Irgendwo hier lagen auch die Schädel ihrer Mutter und ihres Vaters, aber die waren schon vor einiger Zeit gestorben, sodass die Erinnerung an sie verblasste. Ihr Vater war vor zwei Wintern gestorben und so, wie es Sitte war, von den männlichen Angehörigen der Sippe aufgebahrt worden. Inzwischen war das Gerüst verfallen, der Körper verwest, und man hatte den Schädel in den Kreis der Ahnen gelegt. Der Schädelkreis war heilig, und sie wagte sich dort nicht hin. Aber es war schön, in der Nähe zu stehen und seine Gedanken an die „Große Alte“ zu schicken. Sie wickelte das Bisonfell fester um ihren schmalen Leib und trotzte dem eisigen Wind, der um die Palisaden pfiff. „Große Alte!“, murmelte sie liebevoll. „Ich muss dir etwas erzählen.“
So begann sie stets das Gespräch mit den Geistern. Hier konnte sie all ihre Sorgen und geheimen Gedanken hintragen. „Ich bin zur Frau gereift, und Onkel wird nun einen guten Mann für mich suchen.“ Sie seufzte tief, und nur der Wind konnte ahnen, ob aus Sorge oder Vorfreude. Mato-wea knabberte an ihren Lippen. War sie schon bereit für einen Mann? Zu gerne erinnerte sie sich an das Gelächter, wenn sie von den anderen Mädchen mit dem Bisonfell hochgeworfen wurde. Sie war gut darin! Zehnmal war es ihr gelungen, das Gleichgewicht zu halten. Sie kicherte bei dieser Erinnerung. Es hatte so viel Spaß gemacht, mit ihren Freundinnen das alte Spiel zu spielen: Die Mädchen nahmen ein großes Bisonfell, schoben stabile Äste durch die Löcher, die entstanden, wenn man das Fell zum Gerben spannte, und erhielten so einfache Griffe. Die Mädchen hielten das Fell an den Griffen, ein Mädchen kletterte hinauf und wurde von den anderen Mädchen hochgeworfen. Wenn sie mit den Füßen aufkam, wurde sie wieder hochgefedert. Wenn sie stürzte, wurde sie von dem weichen Fell und einen riesigen Haufen Gras, der darunter aufgeschüttet worden war, weich aufgefangen. Es gab immer viel Gelächter, wenn die Mädchen „Hochwerfen“ spielten. Mato-wea hatte damals schon die langen Zöpfe gehabt, und nicht mehr die kurze Frisur mit den beiden Büscheln über den Ohren, die kleine Kinder vor Gefahren schützen sollte.
„Große Alte, bin ich denn schon bereit? Onkel sagt, dass ich ein gutes Mädchen bin und ein Ehemann bestimmt Gefallen an mir finden wird.“ Sie senkte den Blick und bohrte mit dem Mokassin im weichen Pulverschnee, der sich über das Land gelegt hatte. „Onkel ist sehr gut zu mir“, fuhr sie fort. „Und Tante auch …! Aber sie wollen mich vielleicht einem dieser Trapper zur Frau geben. Onkel möchte eine dieser Donnerwaffen haben.“
Sie zögerte, denn sie wollte nicht ungehorsam sein. „Onkel sagt, dass die weißen Männer sehr großzügig zu ihren Frauen sind. Ich könnte froh sein, wenn ich so eine wichtige Aufgabe bekomme. Der Handel mit den Weißen ist wichtig.“
Sie warf einen Blick zum Dorf zurück und senkte dann ihre Stimme zu einem Flüstern. „Aber ich kenne doch die Weißen nicht. Was, wenn ich ihre Sprache nicht spreche? Oder wenn sie böse Geister mitbringen? Die Älteren reden noch von der Zeit, als so viele Menschen wegen einer geheimnisvollen Krankheit gehen mussten. Was, wenn diese Weißen wieder Tod und Verderben bringen? Darf ich diese Sorgen mit meinem Onkel teilen?“
Hoffnungsvoll blickte sie in den Himmel, doch sie konnte kein Zeichen erkennen. Langsam hob sie die Hände und streckte sie der „Alten Frau“ entgegen. „Wache über mich! Lass mich bereit und eine gute Ehefrau sein!“
Sie erhob sich und lief wieder zum Dorf zurück. Sie huschte durch das Tor und wandte sich dem Erdhaus zu, in dem ihre Sippe lebte. Vor dem Eingang hing ein schweres Fell, das sie beiseiteschob, um durch den engen Eingangstunnel ins Innere zu treten. Das Erdhaus war aus vier starken Stützpfosten errichtet, auf denen weitere Balken das Gerüst stellten. Gedeckt war die Hütte aus Ästen und Zweigen, auf denen Schichten von Grassoden und Erde verteilt wurden. Das schützte vor Regen und Kälte. In der Mitte brannte das Feuer, dessen Rauch durch eine Öffnung in der Decke abziehen konnte. Es war ziemlich dunkel im Inneren. Eine Frau saß am Feuer und schnitt Fleisch in einen Topf. Im hinteren Bereich war der erhöhte Bereich des Onkels. Er war verlassen. Wahrscheinlich traf sich der Onkel mit anderen Männern. An den Seiten der Hütte standen erhöhte Betten, die mit Fellen belegt waren. Die Hütte war so groß, dass leicht zehn bis zwölf Menschen Platz hatten. Mato-wea wunderte sich, wo die anderen Familienmitglieder waren. Die Tante hatte eine Tochter, die etwas jünger als Mato-wea war, und noch zwei kleinere Kinder. Außerdem lebten eine Großmutter und eine verwitwete Cousine mit ihrem Sohn bei ihnen. Mato-wea fragte nicht, sondern setzte sich zu ihrer Tante ans Feuer. Sie zog ihr Messer und half der Tante, das Fleisch zu schneiden. Die Tante lächelte freundlich und nickte in Richtung einiger Körbe. „Bringe mir noch etwas Kürbis und Zwiebeln. Dann schmeckt es besser.“
Читать дальше