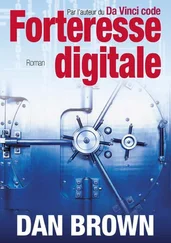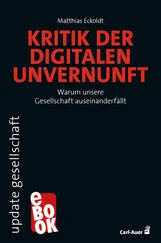Hayles’ Definition, beziehungsweise die Definition der ELO, ist keineswegs unumstritten. In einer Gegenbewegung zu Hayles’ einerseits medial-technischer, andererseits auf die Transformation des Literaturbegriffs orientierter Definition betont etwa Noah Wardrip-Fruin in seinem – gleichfalls noch auf Hypertexte fokussierten – Modell der medienspezifischen Analyse der fünf Elemente digitaler Literatur (Daten, Prozess, Interaktion, Oberfläche, Kontext) die Rolle der »attention to language« in jedweder Kunstform. 16Daneben fallen die Ansätze Phillipe Bootz’ und Friedrich Blocks ins Auge. Für Bootz ist das definierende Merkmal von digitaler Dichtung, dass das technische Artefakt eine »semiotische Lücke« zwischen der sichtbaren Komponente und der technischen Komponente erzeuge, welche dadurch beide als »der« Text angesehen werden können – wenn auch von unterschiedlichen Perspektiven aus. 17Bootz bestimmt die sprachliche Reflexion digitaler Literatur im Spannungsfeld dieser beiden Textebenen und der semiotischen Lücke: »Digital poetry today explores the role of language in signs that use this gap, and which only exist thanks to it. In this case, programming can become a new condition, a new context for poetic creation.« 18Während Bootz digitale Dichtung analytisch als Spannungsfeld von Textebenen und den die semiotische Lücke nutzenden sprachlichen Zeichen fasst, konfiguriert Block digitale »Poesie« im Rahmen seiner disziplingeschichtlichen Analyse des »Sprachspiels« – unter Anleihen bei Luhmann – als intermediales »Reflexions- und Kommunikationsmedium« und »Medium zweiter Ordnung«: »Poesie konzipiert selbstbezüglich Reflexivität als den basalen Mechanismus in Kognition und Kommunikation bzw. Identität und Sozialität. Poesie ist als Reflexions- und Kommunikationsmedium ein Medium zweiter Ordnung.« 19Als ein solches Reflexionsmedium zweiter Ordnung thematisieren digitale Literatur und akademischer Diskurs die Ubiquität des Digitalen als mögliches Problem, etwa in Florian Cramers These, dass die Gegenwart bereits »post-digital« sei. 20Eine digital-literarische Reflexion dieser Problematik ist das von Lori Emerson beobachtete Interface Hacking, welches die »unsichtbar« gewordenen Interfaces wiederum sichtbar zu machen sucht. 21
Ein multimodales Forschungsprogramm
Den diskutierten historischen Zugängen, digitale Literatur zu fassen, ist gemeinsam, dass sie auf mehreren technischen, semantischen und konzeptuellen Ebenen des Werks gleichzeitig ansetzen. Ein Ansatz zur Lektüre und Analyse digitaler Literatur muss, so wurde hergeleitet, multimodal sein: Nicht allein die dynamisch interaktive Bildschirmperformanz eines digitalen literarischen Kunstwerks ist Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses. Vielmehr geraten (auch) der Quellcode, der Datenverarbeitungsprozess, der Code-Schreibprozess, der technische Kontext und deren historische Dimension in den Blick. Jedem Werk der digitalen Literatur sind eine mehrschichtige individuelle, literarische, mediale und technische Geschichte und ein multimodales Bezugssystem eingeschrieben, welche digital-literaturgeschichtliche Bezüge und Kontexte, mediengeschichtliche Aspekte der Bildschirmperformanz und Aspekte historischer digitaler Materialität (historische Aspekte des Quellcode, Programmiersprachen und -Umgebungen, Betriebssysteme und digitalforensische Befunde) umfassen können. 22
Code, Prozess und literarischer Kontext
Cramers Studie »Exe.cut[up]able statements. Poetische Kalküle und Phantasmen des selbstausführenden Texts« 23lenkt den literaturwissenschaftlichen Blick methodologisch auf die Prozess- und Ausführungsebene von poetischen Kalkülen und literarischen Codeworks. Dies ist methodologisch durchaus folgenreicher als in der Forschung gemeinhin wahrgenommen wird, denn Cramers Lektüreansatz erfasst neben Bildschirmperformanz und Quellcode den Nachvollzug des algorithmischen Vorgangs als Teil des Verfahrens: So gelingt Cramer die lesenswerte Analyse der Concrete Perl Poetry Nick Montforts (etwa die 32 Zeichen langen Perl-Programme) 24und des Perl-Gedichts »jabberwocky.pl« (2000) des Programmierers Eric Andreychek. In Cramers Analyse erschließt sich das Code-Gedicht weder aus der sichtbaren Performanz noch allein durch die Textlektüre des Quellcodes, sondern ausschließlich durch den zusätzlichen Nachvollzug dessen, was im Programm-Arbeitsspeicher geschieht: ein Reenactment des Plots von Lewis Carrolls »Jabberwocky« in Form von Variablen, Listen, Systemprozessen (und überlebenden Demons), bei dem der Jabberwocky-Prozess sein Arbeitsspeicher-Leben lässt – während der Prozess »$son« ›überlebt‹: »(kill 9, $Jabberwock), $head = (chop $Jabberwock);«. Das literarische Kunstwerk »jabberwocky.pl« ist sein Quellcode und der unsichtbare Prozess im Arbeitsspeicher zur Laufzeit, während der Output des Gedichts lediglich »Beware the Jabberwock! at jabberwocky.pl line 8. / Beware the Jubjub bird at jabberwocky.pl line 10.« lautet.
Im Sinne eines multimodalen Leseansatzes wären bei der Lektüre von »jabberwocky.pl« mehrere, dem Gedicht in seine literarisch-technische Konzeption wie auch seine Implementierung eingeschriebene Kontextebenen zu berücksichtigen. Perl gilt als eine schwer lesbare Programmiersprache, die gleichwohl zu Beginn der 1990er Jahre zum Ausdruckmedium der Wahl für eine Code-Poetry-Bewegung wurde. 252000 formierte sich die ›PerlMonks‹-Community, der Andreychek wenig später beitrat. 26Montforts Perl-Arbeiten bis hin zu seiner jüngsten, 256 Zeichen langen Hommage an den Chatbot ELIZA, »Eli«, 27sind späte Ausläufer dieser Bewegung, während etwa, zum Vergleich, die Teilnehmer*innen an den Wiener Code Poetry Slams der Jahre 2015, 2016 und 2017 sich mehrheitlich der lesbareren Programmiersprache Python bedienten. 28Nach Flores’ historischem Generationenmodell der digitalen Literatur wäre »jabberwocky.pl« zur ›zweiten Generation‹ zu rechnen. 29
Auf einer technisch-konzeptionellen Ebene ließe sich eine Kontrafakturlinie von »jabberwocky.pl« zurück zur Tradition der algorithmisch generierten Literatur und deren Implementierungen ziehen: Dieses Perl-Gedicht verweigert gerade den direkt lesbaren literarischen Output, den das von Theo Lutz 1959 auf Zuse 22 implementierte Programm der »Stochastischen Texte« erzeugte. Die »Stochastischen Texte«, nach Stracheys »Love Letters« (1952) die ersten algorithmisch generierten literarischen Texte, gehen auf die Zusammenarbeit mit Rul Gunzenhäuser und den nunmehr als politisch belastet geltenden Stuttgarter Professor Max Bense zurück, welcher Lutz’ Werk nachträglich theoretisch unterfütterte. 30
Bis heute verweisen Vertreter*innen des sogenannten konzeptuellen Schreibens – ein Modus des Schreibens, bei dem die formale Fassung einer Idee, eines abstrakten Schemas der ›nebensächlichen‹ Ausführung vorangeht, die zum Beispiel algorithmisch prozessierend erfolgen kann 31– zurück auf diese ersten technischen Implementierungen, wie auch auf die literarischen Konzepte der Wiener Gruppe und der Gruppe OuLiPo. Die historischen Wurzeln der konkreten Code Poetry reichen zweifellos zurück zu den Dichtungen Eugen Gomringers und OuLiPos, etwa François le Lionnais’ ALGOL-Gedicht »Table / Begin: (…)« von 1972. 32Die von Konrad Bayer mit Oswald Wiener 1957–58 auf Papier als Funktionsdiagramm konzipierte, gleichwohl nie implementierte »dichtungsmaschine in 571 Bestandteilen« könnte als ein analoger historischer Prototyp konzeptuellen Schreibens gelesen werden. 33Cramer leitet die Verfahrensweise seiner Code- und Prozessanalyse literaturgeschichtlich her, weit zurückreichend bis zu den kombinatorischen Wortkalkülen Raimundus Lullus’, Quirinus Kuhlmanns, Georg Philipp Harsdörffers, berechtigtermaßen unter anderem auch Friedrich von Hardenbergs »Allgemeines Brouillon«. 34In der reichen literaturhistorischen Reihe vermisst man allenfalls Hölderlins »kalkulable(s) Gesez«, 35seine poetologisch-kombinatorischen Tabellen 36und eine ausführlichere Berücksichtigung der Wiener Gruppe. Kennzeichnend für Cramers historische Analyse ist auch, dass er neben Literaturen der Moderne (Tzara, Schwitters, Gomringer) auch den Einfluss von »Sprachalgorithmik« auf den linguistischen und literaturwissenschaftlichen Strukturalismus berücksichtigt. 37
Читать дальше