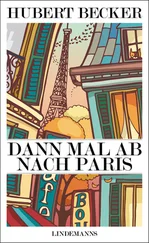Das ging so lange gut, bis ich mich selbst nicht mehr ausstehen konnte. Ich versuchte es noch einmal mit dem Fitnessstudio. Danach kehrte ich etwas entspannter ins Büro zurück und war für den Rest des Tages für meine Umwelt leidlich ertragbar.
Mich selbst befriedigte mein Unvermögen, die Situation in den Griff zu bekommen, jedoch überhaupt nicht. Ich wusste aus Erfahrung, dass ich nur zwei Chancen hatte. Entweder ich brachte sie dazu, sich mir gegenüber so zu verhalten, wie ich es mir wünschte, zumindest teilweise, oder ich war dazu verdammt, eine sehr lange Zeit über sie nachzudenken, immer schwankend zwischen Freude und Hoffnung, Enttäuschung und Rechtfertigungen.
Obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, wie ich sie zu Ersterem überreden sollte, war die zweite Möglichkeit dermaßen kraftraubend und enervierend, wie ich aus mehrfacher Praxis wusste, dass ich sie lieber vermeiden wollte. Ich kam zu dem Schluss, dass ich auf das eine – nämlich Sex – verzichten musste, wenn ich das andere – nämlich meine innere Befriedigung – bekommen wollte.
Eigentlich unvereinbar. Im Zusammenhang mit ihr geradezu unvorstellbar. All unsere bisherigen Begegnungen hatten nur mit Sex zu tun gehabt. Wie sollte ich auf einer anderen Ebene überhaupt an sie herankommen? Unser ganzes Verhältnis – wenn es denn eins gab – beruhte nur auf ›dem Einen‹. Was würde ich einer Frau vorschlagen, die ich gerade erst kennengelernt hatte, einer Frau, mit der ich noch nicht geschlafen hatte und von der ich auch nicht wusste, ob es überhaupt dazu kommen würde?
Das war eigentlich klar. Ich würde etwas ganz Banales vorschlagen, Kino oder essen gehen zum Beispiel. Tja, warum eigentlich nicht? Schlimmstenfalls konnte sie Nein sagen, und dann würde ich endgültig der Verzweiflung anheimfallen.
Ich merkte, wie meine masochistische Ader sich für diesen Entschluss begeisterte. Diese Nacht würde ich ausschlafen, und morgen war auch noch ein Tag. Vielleicht ein Tag, um jemand anzurufen . . .
»Das ist eine etwas ungewöhnliche Verabredung«, sagte sie.
Das war wirklich ›Welt verkehrt‹. Sie fand es völlig in Ordnung, sich zum Sex zu verabreden, aber eine einfache Einladung zum Essen nannte sie ungewöhnlich.
Bislang hatte ich essen gehen für eine relativ gewöhnliche Beschäftigung gehalten. Wenn mich die Arbeit in meinem Job nicht gerade davon abhielt, weil sie meine Sozialkontakte mal wieder sabotierte – manchmal rief man mir schon ›Workaholic‹ hinterher –, ging ich zwei- oder dreimal pro Woche mit einer Freundin zum Essen. Selbst zu kochen war bei meinem Arbeitsvolumen oft unmöglich, und es machte mir auch keinen Spaß für mich allein.
Wenn ich Zeit dazu hatte – was allerdings wirklich sehr selten vorkam –, lud ich am Wochenende ein paar Freundinnen ein und kochte für sie. Entgegen meinem äußeren Erscheinungsbild, das solche ›weiblichen‹ Beschäftigungen nicht gerade nahelegte, kochte ich sehr gut. Meine Aufläufe waren berühmt.
»Zu ungewöhnlich, um sie anzunehmen?«, fragte ich direkt. Mir schien, es hatte keinen Sinn, um den heißen Brei herumzureden. Ihre Entscheidung war vermutlich von Kriterien abhängig, die ich nicht kannte – so wenig, wie ich sie kannte. In meinem Kopf schwirrten ein paar Gedanken umher, was ich tun würde, wenn sie ablehnte: ein paar Luftballons vor ihrem Fenster steigen lassen mit ›Happy Birthday‹ darauf? Ich wusste ja nicht einmal im Entferntesten, wann sie Geburtstag hatte. Was ich auch tat, ich würde mir nur einen Korb holen. Ich liebte es, mich von einer Frau frustrieren zu lassen, in die ich unglücklich verliebt war!
»Zu ungewöhnlich, um nicht darüber nachzudenken«, sagte sie gerade.
Sie ließ sich nicht überrumpeln. Weder geschäftlich noch privat. Das konnte ich mir gut vorstellen. Doch ihre kühle Art reizte mich besonders. Ich wollte wissen, was dahintersteckte.
»Aber ich kann dir jetzt noch keine Antwort darauf geben.«
Sie fuhr so gleichmütig fort, dass ich mich dafür hätte ohrfeigen können, sie überhaupt angerufen zu haben. Ihr lag überhaupt nichts daran, sich mit mir zu treffen. Außer vielleicht beruflich, aber das war nicht das, was ich ihr angeboten hatte. Oder war es das, was sie abhielt? Musste sie erst entscheiden, in welche Kategorie ich gehörte: Kundin oder – ja, oder was?
»Kannst du mich nächste Woche noch einmal anrufen?«
Was! Nächste Woche? Verdammt noch mal, was tat ich denn hier? Sie wollte doch gar nicht! »Ja, sicher. Wann – wann bist du denn am besten zu erreichen?« Die Vorstellung, sie bei der ›Arbeit‹ zu stören, war mir unerträglich.
»Das merkst du dann schon«, sagte sie.
Natürlich – entweder sie nahm ab oder sie war ›beschäftigt‹. Warum quälte ich mich so? Weil du das immer tust. Weil du die Frauen am begehrenswertesten findest, die dich abweisen. Es ärgerte mich, aber ich konnte meinem Kopf noch nicht einmal widersprechen. Er hatte einfach recht. Und ehrlich gesagt war das wahrscheinlich der einzige Grund, warum wir überhaupt zusammengekommen waren. Es hatte mich gereizt, ihr kühles An-mir-vorbei-Blicken, ihre Gleichgültigkeit, gespielt oder echt. Mittlerweile sollte ich vielleicht doch erkennen, dass es echt gewesen war. Ich hätte gern etwas anderes vermutet.
»Gut, aber bevorzugst du einen bestimmten Tag?« Meine Stimme klang ganz sicher etwas sarkastisch. Ich hatte keine Lust, jeden Tag bei ihr anzurufen und erst nach der ganzen Woche Erfolg zu haben. So weit ging mein Masochismus denn doch nicht.
Sie lachte – tatsächlich, sie lachte! »Du bist sauer«, bemerkte sie.
»Wundert dich das?« Jetzt war ich wirklich eingeschnappt. Sie hatte mich ausgelacht! So etwas vertrug ich überhaupt nicht. Und im Übrigen wurden meine Einladungen zum Essen im Allgemeinen mit mehr Begeisterung aufgenommen. Ich müffelte vor mich hin.
Und sie ging nicht darauf ein! »Ich bin vor Mittwoch nicht zu erreichen, wenn dir das hilft.«
»Oh ja, das hilft mir sehr. Vielen Dank!« Ich knallte wütend den Hörer auf die Gabel. Wofür hielt sie mich eigentlich? Wahrscheinlich für genau das, was ich war: eine Hündin, die an ihrer Tür kratzte. Ich war mir selbst peinlich, aber ich konnte noch nicht aufgeben. Immerhin hatte sie nicht Nein gesagt.
Ich überhäufte mich selbst mit Arbeit und versuchte, nicht ständig an sie zu denken. Das Projekt hatte schon lange nicht mehr so schnelle Fortschritte gemacht.
Mit dem Nicht-an-sie-Denken hatte ich weniger Erfolg. Jede freie Minute war mit Gedanken an sie gefüllt. Mitten im Bearbeiten eines Formulars, mit dem ich eine Erweiterung des Projektbudgets um eine halbe Million beantragen wollte, sah ich sie in ihrem Morgenmantel vor mir, wie sie mir zulächelte.
Ich wollte sie ausziehen, um mich an ihr zu rächen, aber es ging nicht. Ich konnte sie mir einfach nicht nackt vorstellen. Ich wusste schon, warum. Ihren Körper hatte sie mir bereitwillig zur Verfügung gestellt. Dort verhüllte sie nichts. Von ihrer Seele hatte ich jedoch bisher nur ein winziges Stück erhascht, als sie nicht aufpasste. Das, was mich interessierte, war der Rest, der zu diesem kleinen Stück gehörte. Der war allerdings sehr verhüllt. Und sie würde ihn kaum freiwillig preisgeben.
Im Laufe der Woche kam ich zu dem Entschluss, es nur noch ein letztes Mal zu versuchen. Ich konnte mich doch nicht lächerlich machen! Ob ich diesen Entschluss würde einhalten können, wusste ich nicht. Sie beherrschte meine Gedanken vollkommen.
Das Schlimmste daran war, dass ich mir vorstellte, sie würde sicher keinen einzigen Gedanken an mich verschwenden. Wahrscheinlich amüsierte sie sich mit irgendeiner Frau, die ihr mehr zu bieten hatte als ich.
Die Tage schlichen dahin wie Szenen in einem schlechten Film. Mir fiel unsere erste Begegnung wieder ein, in einem Frauencafé namens Bella Donna . Wie merkwürdig bezeichnend. Genau das war sie: eine schöne Frau und – wie es mir jetzt vorkam – ein schleichendes, tödliches Gift.
Читать дальше