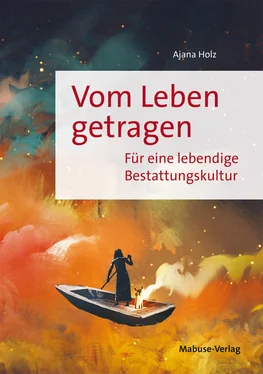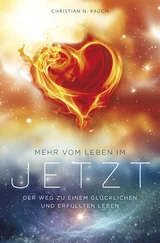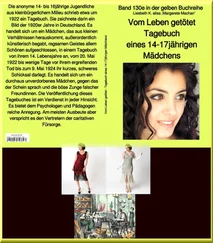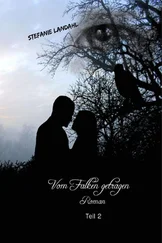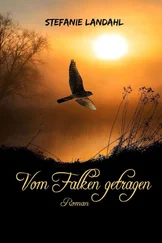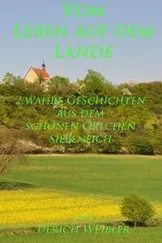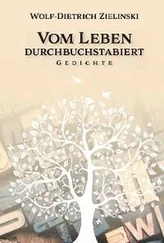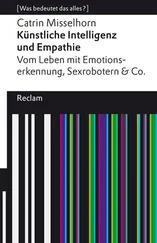Das Bezeugen dieses Schrittes bei diesem Übergang ist ein sehr wichtiger Akt und macht das Geschehen in vieler Hinsicht erst real für diejenigen, die diesen Schritt nun wagen. Es verankert diesen großen Schritt, diesen Beginn in der Wirklichkeit ihres Lebens. Diese ZeugInnenschaft hat in vielen Lebenssituationen eine sehr entscheidende Bedeutung. Auch das Bezeugen von schlimmen Dingen, wie zum Beispiel Gewalterfahrungen, ist sehr wichtig …
Kritisch anzumerken ist bei der Heirat natürlich, dass noch immer zu oft ein starker gesellschaftlicher Druck zwei Menschen zur Heirat nötigt, dass Frauen mehr geachtet sind, wenn sie „ordentlich“ verheiratet sind, und leider noch immer dadurch stärker von der Gesellschaft akzeptiert werden als unverheiratete Frauen, die von vielen Seiten damit genervt werden, wann sie den „Richtigen“ denn nun finden. Ebenso kritisch sehe ich, dass andere Lebensformen weder gesetzlich noch gesellschaftlich gleichwertig anerkannt sind: unverheiratete Paare, Menschen in selbst gewählten und für sie bedeutsamen Lebens- und Wohngemeinschaften, Menschen, die sich gemeinsam um Kinder und/oder pflegebedürftige Menschen kümmern, ohne deshalb in Paarbeziehungen zu leben, Menschen, die sich ohne PartnerIn um Kinder kümmern (sogenannte Alleinerziehende) usw.
Aber am Beispiel des Rituals der Heirat wird sehr deutlich, was wirklich im Übergang wichtig ist: eine bestimmte Vorbereitung, ein besonderer Zeitraum, der sehr bewusst gestaltet und begangen wird – und ganz wichtig: andere, die bezeugen und spiegeln, dass es real ist, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt, dass alle Gefühle da sein dürfen und willkommen sind. BegleiterInnen, die diesen Raum und diese Zeit schützen, die im vollen Umfang und ganz ohne Wertung anerkennen, wissen und sich davon berühren lassen, was es bedeutet, diesen Schritt zu wagen, der immer auch ein Schritt ins Unbekannte ist und deswegen Mut erfordert: entweder die Verbindung mit einer anderen Person öffentlich zu würdigen und zu feiern – oder wahrhaftig und ganz in Berührung damit zu gehen, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Und das bedeutet für die BegleiterInnen immer: mit dem Herzen in Berührung zu gehen – im Falle einer Bestattung mit der Trauer und dieser/diesem Toten. Denn nur dann können sie wirklich angemessen begleiten. Es bedeutet auch, die Menschen zu bestärken, in der Situation des Übergangs ihren eigenen Weg zu gehen, herauszufinden, was für ein Weg das ist, ihre Wahrnehmung dafür zu stärken, was für sie in dieser Situation stimmig ist, und sie zu unterstützen, einen Ausdruck dafür zu finden. Es bedeutet, jedes Mal von Neuem offen zu sein für den Weg der Begleiteten, nicht zu werten und die eigenen Erfahrungen nie als allgemeingültige Prognosewerkzeuge zu benutzen für das „richtige Ergebnis“ eines Überganges. Eine ganz klassische Trauerkarte kann ein ebenso stimmiger Ausdruck sein wie ein Sarg, bunt beschrieben mit guten Wünschen aller Abschiednehmenden. Mit erdigen Gummistiefeln vom Acker und nur mit den TrauzeugInnen zum Standesamt zu gehen kann genauso stimmig sein wie die Hochzeit im Wasserschloss mit Smoking, Brautkleid und 200 GästInnen.
Übergangsbegleitung 28
Wir nehmen die Toten wieder in unsere Mitte
und heben für diesen Moment
die zerstörerische Trennung von Leben und Tod auf.
Leben und Tod – Geburt und Sterben gehören zusammen,
gehören zu unserem Leben,
gehören in unsere Mitte.
Jeder Tod macht uns die kostbare Einmaligkeit unseres Lebens bewusst
und jede Geburt lässt uns das Wunder des Lebens neu erfahren.
Die Ehrfurcht vor Leben und Tod lehrt uns Respekt vor der Natur, der Erde,
die uns nährt,
und den Frauen, durch die alle Menschen geboren werden,
die ein tiefes Wissen über Geburt und Tod – über die Lebensübergänge – in sich tragen.
Trennung, Abschied und Trauer gehören zu unserem Leben, wie der stetige
Wandel,
der das Einzige ist, dessen wir uns wirklich sicher sein können.
Ein endgültiger Abschied beim Tod von einer uns nahestehenden Person kann nur dann wirklich gut in das Leben integriert werden, wenn auch die Verstorbenen wieder einen Raum in unserem Leben bekommen – wenn möglich noch bevor wir sie zu Grabe tragen, in diesen so wesentlichen und wichtigen Tagen zwischen Tod und Bestattung, in denen die wichtigsten Trittsteine für den Weg der Trauernden gelegt werden können.
BegleiterInnen können hier wesentlich zur Heilung des tiefen Schmerzes und des Schocks beitragen, wenn sie ohne Angst oder Ekel in Berührung mit den Toten gehen, die Verstorbenen mit Liebe und Respekt behandeln und selbstverständlich
die Angehörigen ermutigen,
mit ihren Toten zu sein.
Berührung auf allen Ebenen geht nur mit bedingungsloser, allumfassender Liebe, die alle Menschen, alle Lebendigkeit mit einbezieht – und Tod als eine Seite des
Lebens begreift.
Da sein. Sich einlassen. Sich berühren lassen,
von allem, was in diesem Moment ist.
Das ist Begleitung, die von Herzen kommt
und einen heilsamen Raum für den Abschied schafft.
Hygienische Totenversorgung:
Zwischen Notwendigkeit und Körperverletzung
Heute werden die Toten in der Regel nicht mehr gewaschen. Es gibt den Beruf der Leichenwäscherin/des Leichenwäschers nicht mehr (den gab es tatsächlich in den Kliniken bis in die 1970er-Jahre noch). In den Kliniken und Pflegeheimen haben die Pflegekräfte dafür meist zu wenig Zeit. Die reicht ja kaum noch für die lebenden PatientInnen. Es ist ein Skandal, wie wir als Gesellschaft mit der so wichtigen Pflegearbeit umgehen, dass Kliniken wirtschaftlich arbeiten müssen und deshalb vor allem Pflegepersonal einsparen, obwohl seit Jahren klar ist, dass viel mehr Pflegekräfte nötig wären, um dieser verantwortungsvollen Arbeit gerecht zu werden und dabei menschlich zu bleiben: sowohl gegenüber den Pflegenden als auch denjenigen gegenüber, die der Pflege bedürfen. Die unterschiedliche Bewertung von (Lohn-)Arbeit in unserer Gesellschaft ist nicht nur in finanzieller Hinsicht noch lange nicht annähernd gerecht oder nachvollziehbar. Da mit dem Tod auch die Krankenversicherung endet, gibt es kein Geld, mit dem die Arbeitszeit von Pflegekräften finanziert werden könnte, um die Toten zu versorgen und Angehörige in die (meist vorhandenen) Abschiedsräume zu begleiten, wenn sie in Ruhe Abschied nehmen wollen.
Denn in Kliniken müssen die Verstorbenen meist sehr schnell nach dem Tod in die Pathologie gebracht werden oder dorthin, wo sich die Leichenkühlräume (und meist auch die Abschiedsräume) befinden. Diese Räume sind in aller Regel irgendwo ganz abseits im Keller, neben Lagerräumen, Wäscherei, Putzmitteln, Müllentsorgung etc.
Hier beginnt schon deutlich zu werden, dass Tote offensichtlich ähnlich wie Müll eingeordnet werden, etwas, das sicher und schnell entsorgt werden muss – unserem Blick entzogen, möglichst weit weg geschafft. In den medizinischen Ausbildungen kommt der Umgang mit Verstorbenen (außerhalb von Obduktionen) und mit trauernden Angehörigen nicht oder nur sehr rudimentär vor, wie uns von Pflegenden, Ärztinnen und Ärzten in unseren Fortbildungen immer wieder berichtet wird. Im normalen Klinikbetrieb und in den medizinischen Ausbildungen geht es in erster Linie darum, PatientInnen am Leben zu erhalten, und darauf muss sich konzentriert werden. Für Sterbe- oder Trauerbegleitung ist da kaum Raum und Zeit. Erst langsam beginnt hier ein Bewusstseinswandel, der auch die Möglichkeit miteinbezieht, dass es nicht immer nur ein medizinisches Versagen ist, wenn Menschen – trotz aller Bemühungen – sterben, und dass es eine durchaus sehr menschliche Entscheidung sein kann, irgendwann, nach gemeinsamer Beratung mit PatientInnen und Angehörigen, mit der Behandlung aufzuhören. Manche Kliniken haben deshalb Palliativstationen eingerichtet, wo nur noch das medizinisch Nötigste gemacht wird, zum Beispiel eine Schmerzbehandlung, und wo mehr Raum für die notwendige menschliche Sterbebegleitung ist.
Читать дальше