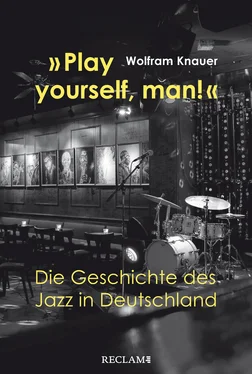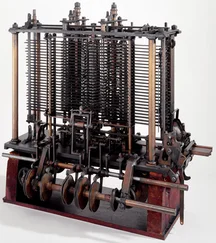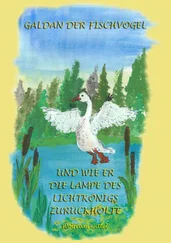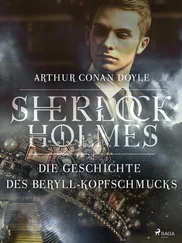Kurze Weltoffenheit: Olympia
Quasi zeitgleich mit den Versuchen, die Tanzmusik als eine deutsche umzudefinieren und von angeblich fremden und verderblichen Einflüssen zu befreien, beorderte man, wie Peter Köhler, ein Kenner deutscher Jazzgeschichte jener Jahre berichtet, »19 der bekanntesten Kapellmeister nach Berlin. Dort bekamen sie den Auftrag, sich aus Amerika und England die neusten Swing- und Jazztitel zu besorgen.«111 Wie erklärt sich dieser Zwiespalt? Nun, die Olympischen Spiele standen bevor, und Berlin wollte sich – auch musikalisch – als eine weltoffene Metropole darstellen, die London, Paris oder New York in nichts nachstand.
Teddy StauffersOriginal Teddys begannen ihr Engagement im Delphi-Palast am 1. Juli 1936, woran sich Stauffer in seiner Autobiographie erinnert: »Wir kamen einen Monat vor der Eröffnung der Olympischen Spiele an. Die Stadt lebte im Olympiafieber. Unter den Linden, vom Rathaus bis zum Brandenburger Tor, stellten sie schon Fahnenmasten auf. An den Wänden und auf Dächern wurden Scheinwerfer installiert. Im funkelnagelneuen Reichssportfeld wurden die Bänke noch einmal geputzt. Aber nicht nur Sportler, sondern Uniformträger beherrschten das Straßenbild. Jungvolk, Jungmädchen, Hitler-Jugend, Bund Deutscher Mädel, SA, SS, NSKK, NSFK. Es gab nichts mehr, was nicht organisiert und uniformiert war. Wir spielten im Delphi. Das Publikum tobte. Je mehr wir swingten, umso größer war der Beifall. Allerdings bestand unser Publikum aus Zivilisten. Sie machten auf diese Weise deutlich, dass sie mit den Uniformierten nichts zu tun hatten.«112
Während der Olympischen Spiele von 1936 also ließ das Regime die kulturellen Zügel locker und Musik erklingen, die ansonsten verpönt war. Herb Fleming spielte in der Sherbini Bar, und Bands wie die von Teddy Stauffer und Aage Juhl Thomsen zeigten sich mehr als Jazz- denn als zurückhaltende Tanzorchester.113 Der Saxophonist Teddy Stauffer war 1909 bei Bern geboren worden und hatte in den 1920er Jahren angefangen, in der Schweizer Hauptstadt Jazz zu spielen. 1928 ging er nach Berlin, wo er die Begleitmusik für ein politisch-satirisches Kabarettprogramm besorgte. Bald machten seine Original Teddies Karriere und traten in ganz Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden auf. 1935 ergatterte er ein Engagement in der Bordkapelle für eine Nordlandreise auf der SS Reliance, die am 11. Juni in New York begann und mehrere Monate dauerte. Am 14. Juli 1936 spielte er in Berlin »Goody Goody« ein, das Benny Goodman nicht einmal ein halbes Jahr zuvor aufgenommen hatte und das angesichts des Erfolgs sofort zu Stauffers Titelsong wurde. Tatsächlich sollte man sich Goodmans Originalversion im Arrangement von Henry Woode vor Ohren halten, wenn man Stauffers Interpretation hört. Goodmans Band hat einen antreibenden Drive; das Orchester wird gleich nach dem Thema von der Klarinette des Bandleaders überstrahlt, bevor Helen Ward den Text singt und Goodman zu einem virtuosen Solo als Höhepunkt der Aufnahme ansetzt. Stauffers Fassung ist schon im einleitenden Themenstatement merklich steifer, etwa in den Blechakzenten im letzten Achttakter vor der Modulation zum Gesangsteil. Dieser wird vom Gitarristen und Refrainsänger Billy Toffel ordentlich, wenn auch nicht wirklich glaubhaft übernommen, bevor ein arrangierter Chorus für den Saxophonsatz das Klarinettensolo ersetzt, an das sich beim Vorbild Goodman wohl niemand so recht herantraute. Und dann, in der ersten Hälfte des letzten Achttakters, ist der Arrangeur des Titels, Walter Dobschinski, mit einem kurzen Posaunensolo zu hören, das deutlich aus allem herausragt, was die Band in diesem Titel sonst zu bieten hat: ein selbstsicher-entspanntes Einschleifen in den Ton, ein Bewusstsein dafür, dass swing nicht nur im Setzen der Akzente, sondern auch im Umgang mit dem Sound innerhalb derselben entsteht, ein perfekter Melodiebau und zum Schluss ein leichtes abfallendes Glissando, bei dem man jeden der darin enthaltenen Töne zu hören meint. Vier Takte nur, aber man erkennt in dieser Band, die nach wie vor mit dem so fremden Phänomen des swing zu kämpfen hat, mindestens einen Musiker, der es verstanden hat, der ohrenfällig nicht abliest, sondern seinen Beitrag aus dem Bauch heraus spielt.
Dobschinski war auf der Nordlandreise ebenfalls in der Band gewesen und hatte in New York den Posaunisten des Casa Loma Orchestra kennengelernt.114 Für Stauffers Programm arrangierte er viele Titel, von denen etliche dem amerikanischen Repertoire entstammten. Für das Repertoire vieler der Tanzorchester hatte schon vor der Machtergreifung der Nazis die Faustregel gegolten: Die meisten der schnellen Tanznummern wurden aus dem US-amerikanischen Repertoire übernommen; Balladen, Schlager oder als »exotisch« geltende Nummern wie Tangos oder Rumbas etc. waren dagegen meist Eigenkompositionen.115 Als Hauptquelle dienten amerikanische Schallplatten. Der Pianist Georg Nettelmann etwa transkribierte, nachdem es ab 1933 immer schwerer wurde, amerikanisches Notenmaterial zu erhalten, einfach die Arrangements von Titeln, die ihm und seinen Musikern besonders am Herz lagen.116
Im Goodman-Hit »Swingtime in the Rockies« vom Oktober 1936 gelingt Stauffers Band der Drive schon überzeugender, und neben Dobschinski hatte Stauffer mit dem Trompeter Kurt Hohenberger, dem Klarinettisten Ernst Höllerhagen und den Saxophonisten Benny de Weille und Eugen Henkel bald weitere Solisten, die nicht nur die Arrangements zusammenhielten, sondern auch solistisch etwas zu sagen hatten. Vom September 1938 etwa stammt der »St. Louis Blues«, der als eine von Dobschinski intonierte Elegie beginnt, auf die eine gerade in ihrer Simplizität großartige Klarinettenpartie Höllerhagens folgt. Das Arrangement wechselt ins fast doppelt so schnelle Tempo, man hört ein sicheres Saxophonsolo Benny de Weilles, komplexe, dabei überzeugend dargebotene Satzarbeit aller, ein mit Versatzstücken des Boogie Woogie arbeitendes Klaviersolo und dann, als Höhepunkt, ein mitreißendes Geigen-, nein, man muss fast sagen Fiddle-Solo des im Saxophonsatz sitzenden, aus Budapest stammenden Bertalan Bujka, das in ein antreibendes Duo zwischen Bujka und dem Akkordeonisten Buddy Bertinat mündet. Der Vergleich allein dieser drei Titel – und man könnte etliche andere wählen – zeigt die Entwicklung: eine anfängliche Unsicherheit mit dem Swing-Idiom, die vor allem im Rhythmischen spürbar ist und in überzogenen oder einfach nur gegen den swing gesetzten Akzenten besonders deutlich wird; die wachsende Vertrautheit mit Arrangements, die aber immer noch wichtiger sind als improvisierte Solopassagen; und schließlich die Einbettung der inzwischen engagierten und vom Publikum beklatschten Solisten, die dem amerikanischen Original des Swing nacheifern und dabei immer wieder ganz eigene Höhepunkte erzielen.
Wenn man Stauffers bis 1939 ausschließlich in Berlin eingespielte Aufnahmen hört, mag man am Erfolg des Versuchs, Jazz und Swing aus deutschen Tanzsälen zu verbannen, stark zweifeln. Tatsächlich aber hatte auch Stauffer regelmäßig Ärger mit Kontrolleuren der Reichsmusikkammer, doch als Schweizer konnte er es sich leisten, die Vorschriften etwas lascher zu sehen. Stauffer wurde besonders von Hans Brückner angefeindet, einem Schlagerkomponisten, der 1928 in die NSDAP eingetreten war und als Herausgeber der Zeitschrift Das Deutsche Podium ( Fachblatt für Unterhaltungsmusik und Musik-Gaststätten ) gegen den Jazz wetterte.
Brückner hatte 1935 zusammen mit Christa Maria Rock das Buch Das musikalische Juden-ABC herausgebracht, in dem sie auf 175 Seiten gegen jüdische Komponisten, Librettisten, Musiker, Sänger und andere hetzten und das nach etlichen Protesten gegen inhaltliche Fehler selbst der Reichsmusikkammer zu ideologisch war.117 Mutmaßlich spielte aber auch Eitelkeit eine gewisse Rolle. Nachdem Stauffer im Oktober 1936 Brückners Schnulze »Zwei Schwalben haben sich geküsst« aufgenommen hatte, ließ dessen Kritik nach. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war Stauffer in Zürich engagiert. Er besuchte 1941 die USA und entschied sich, nachdem er dort keine Aufenthaltsgenehmigung erhalten hatte, in Acapulco im benachbarten Mexiko einen Nachtclub zu eröffnen.
Читать дальше