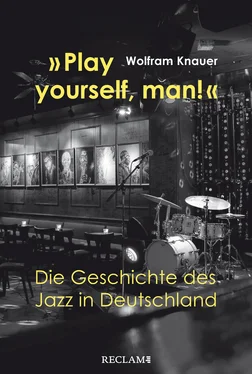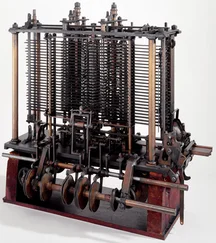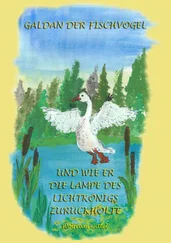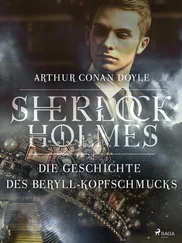In seiner Regierungserklärung vom 23. März 1933 bezeichnete Adolf Hitler die »moralische Sanierung an unserem Volkskörper« als kulturelle Hauptaufgabe und bettete in diese insbesondere auch die Künste ein. In der Erklärung hieß es konkret: »Unser gesamtes Erziehungswesen – das Theater, der Film, Literatur, Presse, Rundfunk – sie werden als Mittel zu diesem Zweck angesehen und demgemäß gewürdigt. Sie haben alle der Erhaltung der im Wesen unseres Volkstums liegenden Ewigkeitswerte zu dienen; die Kunst wird stets Ausdruck und Spiegel der Sehnsucht oder der Wirklichkeit einer Zeit sein.«98
Reichspropagandaminister Joseph Goebbels erließ am 1. November 1933 die »Erste Durchführungsverordnung des Reichskulturkammergesetzes«, die jeden Kulturschaffenden zwang, in einer von sieben Reichsfachkammern Mitglied zu sein, die Musiker eben in der Reichsmusikkammer. Ab 1935 überprüfte man alle Mitglieder und Bewerber auf ihre »arische« Abstammung; ab 1938 wurden die Namen ausgeschlossener Mitglieder in den Amtlichen Mitteilungen der Reichsmusikkammer veröffentlicht.99 Nichtarier hatten also keine Chance mehr, in einer dieser Fachkammern aufgenommen zu werden; und ohne Mitgliedschaft gab es keine Möglichkeit, den künstlerischen Beruf auszuüben. Selbst Vertragsvordrucke enthielten bald den Passus: »Vertragsschließender versichert, dass er Arier und Mitglied der Reichsmusikkammer ist.«100
Da nun die Menschen zu Marschmusik nicht tanzten und die aufkommende Swingmusik der 1930er Jahre junge Menschen ganz unideologisch begeisterte, begannen die Verantwortlichen eine Umdefinition dessen, was deutsche Unterhaltungsmusik sein und was sie nicht enthalten dürfe. Goebbels strebte eine »volksverbundene deutsche Tanzmusik« an, und da anfangs niemand wusste, was er damit eigentlich meinte, begannen Musiker der Salonorchester, die sich in den 1920er Jahren die modischen Jazzinstrumente Banjo und Saxophon zugelegt hatten, diese zumindest weniger einzusetzen. Diese Reaktion führte zu ernsthaften Absatzschwierigkeiten auf dem Instrumentenmarkt, so dass das Reichswirtschaftsministerium sich genötigt sah, einzuschreiten und einen Bescheid zu erlassen mit dem Titel »Zur Ehrenrettung des Saxophones«, in dem die Autoren beteuerten, dieses Instrument sei an der Ausbreitung »der Negermusik« völlig unschuldig. Die Zeitschrift Musik-Echo erläutert in ihrer Ausgabe vom Oktober/November 1933, in der dieser Bescheid des Ministeriums abgedruckt wurde, unter der Überschrift »Was sind Jazzinstrumente?«, dass Jazz doch nur eine Art zu Musizieren sei, einzelne Instrumente also nicht einzig für den Jazz vereinnahmt werden dürften. Es habe, wird als Beispiel angeführt, »in einer nordbayerischen Stadt« bereits »ein Verbot des Spielens auf dem Piano-Akkordeon« gegeben, obwohl dieses doch tatsächlich »eines der ältesten deutschen Instrumente« sei. Ähnlich gelagert sei die Situation bei Instrumenten wie Trompete oder Saxophon. »Keinesfalls«, heißt es weiter, »sollte man ganze Instrumentengruppen verurteilen und damit ganze Industrien vernichten, nur weil eine gewisse Art des Gebrauchs der Instrumente abzulehnen ist.«101 »Jazz, gut angewendet«, fährt der Autor fort, »kann durchaus melodisch und schön sein, hat aber nur deshalb so einen üblen Nimbus erhalten, weil man alles, was eine kleine Tanzkapelle von 2 (!) bis 6 Mann hervorzauberte, mit ›Jazz‹ bezeichnete.«102
Ein anderer Autor bemängelt in derselben Ausgabe des Musik-Echo s (die übrigens auch eine glühende Konzertrezension Duke Ellingtons enthält, der mit seinem Orchester gerade im holländischen Scheveningen gastiert hatte), der Begriff Jazz werde viel zu oft falsch verwendet und sei deshalb zum »Inbegriff schlechten Musizierens« geworden; man solle das Wort lieber beiseitelassen und sich auch musikalisch auf die Qualitäten gut gespielter Tanzmusik konzentrieren. »Spielen Sie lieber«, heißt es da, »eine ordentliche Tanzmusik in einem sauberen Stil, dezent und tonrein.«103 Im Nachwort zum Bescheid des Reichswirtschaftsministeriums über die Unbedenklichkeit des Saxophons kommentiert die Redaktion des Musik-Echo s dann noch das Problem der unklaren Terminologie. So genau wisse man ja nicht, was »Negermusik« oder »Jazzmusik« überhaupt sei; wahrscheinlich meinten die Ministeriellen damit »die in den vorherstehenden Artikeln bereits gegeißelte Art, schlecht zu musizieren«104.
Um also die Unklarheit aufzulösen, die allerorten darüber herrschte, was denn nun von Regierungsseite gutgeheißen und was nicht gewünscht war, beeilte sich Arnd Robert bereits in der nächsten Ausgabe des Musik-Echo , in einem Artikel, der überschrieben war mit »Moderne Tanzmusik – wie sie gespielt werden sollte!«, auch technische Hinweise zu geben.105 Insbesondere der Schlagzeuger, heißt es da, sei zwar »unentbehrlich für die Tanzmusik«, müsse sich aber in der Lautstärke und bei seinen Effekten zurückhalten und auf das Einhalten eines »richtigen Rhythmus« beschränken.
Man wollte das Volk offenbar mit Nachdruck zur »richtigen« Musik erziehen, denn in derselben Ausgabe findet man einen Artikel des Herausgebers Adalbert Schalin über »Neue Deutsche Tanzmusik« und von Reinhold Sommer einen, in dem er erklärt, wie der deutsche »Tanz der Zukunft« aussehen könne. Es sollte im Februar/März 1934 noch eine weitere Ausgabe des Musik-Echo geben, in dem ein Karikaturist vorhersagt: »1934 wird jeder Kapellmeister größten Wert auf eine kultivierte Konzert- und Tanzmusik legen – ›Det hab’ ich jern.‹«106 Arnd Robert durfte noch einmal den Einsatz des Wah-Wah-Dämpfers in Duke Ellingtons »It Don’t Mean a Thing« erklären,107 doch dann war Schluss. Der jüdische Herausgeber und Besitzer des Schallplattengeschäfts Alberti floh aus Deutschland, und das Musik-Echo musste sein Erscheinen einstellen.
Die Daumenschrauben wurden also angezogen, und in den schriftlichen Angriffen und den vorsichtigen Rückzugsrechtfertigungen der Tanzmusik-Vertreter können wir den schwelenden ästhetischen und kulturpolitischen Kampf gut nachvollziehen. Wie aber sah es mit der Musik aus?
Anfangs waren es, wie bei Ernst Kreneks Jonny spielt auf , Demonstrationen der Braunhemden oder Stinkbomben im Theater. Peter Kreuder(geb. 1905) konzertierte im Februar 1932 mit seinem 18-köpfigen Jazz-Symphonieorchester in der Münchner Tonhalle mit einem Programm, das Spezialarrangements amerikanischer Jazzschlager enthielt, aber auch eine Komposition von Friedemann Bach, die Kreuder für Jazzgeige, zwei Gitarren und zwei Stimmen arrangiert hatte, sowie Gershwins »Rhapsody in Blue«. Die SA hatte Störaktionen angedroht, und der Völkische Beobachter beschwerte sich nach dem Konzert darüber, »der Dirigent Moritz [!] Kreuder möge sich doch samt seinen Kastratensängern nach Afrika begeben, seine Künste dort zu zeigen, es würde sich aber sicher kein Hottentott finden, ihn dort zu halten«.108
Am 12. Oktober 1935 sprach der Reichssendeleiter Eugen Hadamovsky nach einem Entschluss der Intendantentagung in München ein landesweites Sendeverbot für Jazz im Rundfunk aus, oder, um es im Original zu zitieren: »Nachdem wir zwei Jahre lang aufgeräumt haben und Stein an Stein fügten, um in unserem Volke das versammelte Bewußtsein für die deutschen Kulturwerte wieder zu wecken, wollen wir auch mit den noch in unserer Unterhaltungs- und Tanzmusik verbliebenen zersetzenden Elementen Schluss machen. Mit dem heutigen Tag spreche ich ein endgültiges Verbot des Nigger-Jazz für den gesamten deutschen Rundfunk aus.« Drei Jahre später wurde eine Reichsprüfstelle gegründet, die sicherstellen sollte, »ob ein Tanzmusikstück tragbar oder als Jazzmusik abzulehnen ist«.109
Um den Rundfunkhörern klar zu machen, welche Musik sie auf keinen Fall einschalten sollten, erfand die Reichsmusikkammer das Sendeformat »Vom Cakewalk zum Hot«, das – ähnlich wie wenig später die Ausstellung »Entartete Kunst« – den Hörern die missliebige Musik vor Ohren führen sollte. Die Wirkung war allerdings eher konträr, da etliche Hörer durch solche Aufnahmen überhaupt erst auf den Jazz aufmerksam wurden. Die Musik zur Sendung stammte vom Orchester des Pianisten Erich Börschel(geb. 1907), der nach einer damals nicht unüblichen Karriere zwischen Klassik und Unterhaltungsmusik im Frühjahr 1933 in Königsberg sein eigenes Tanz- und Unterhaltungsorchester gegründet hatte. Wie genau das geklungen hat, was in der Sendung zu hören war, wissen wir nicht, aber der »Wabash Blues«, den Börschel 1935 einspielte, lässt ahnen, dass die Band eine eher klischeehafte Vorstellung von Jazz besaß: Alles ist ausgeschrieben, selbst die als Breaks gedachten Antworten auf das Ensemblethema; scotch-snap-artige Synkopen ersetzen das, was als Offbeat-Phrasierung gedacht war; die Entwicklung des Stücks geschieht nirgends durch solistische Einwürfe, sondern einzig durch die arrangierte Verlagerung der Themenmelodie auf verschiedene Instrumente. Parallel dazu wurde im Rundfunk ein Tanzkapellenwettbewerb ausgerufen, dessen Ergebnisse bei den Hörern allerdings so wenig ankamen, dass Fritz Stege, einer der Mitinitiatoren des Wettbewerbs, schließlich feststellen musste: »Wenn aber eine Einrichtung derart im Volke Wurzeln geschlagen hat wie der Jazz, dann ist es nahezu unmöglich mit Verboten allein Erfolg zu erzielen, wenn man nichts Besseres an die Stelle der Jazzband zu setzen weiß.«110
Читать дальше