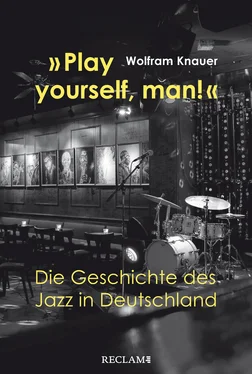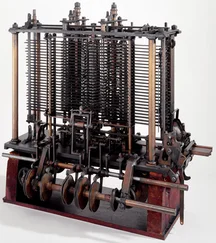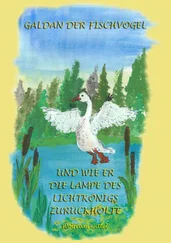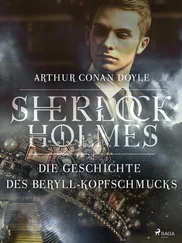Im Rückblick wirkt die Fröhlichkeit, die sich im Unterhaltungsgewerbe der frühen 1930er Jahre abbildet, in den Theatern, Cabarets, Clubs und Ballsälen, in der Musik von Ensembles, die immer professioneller wurden, wie der sprichwörtliche Tanz auf dem Vulkan . So hieß ein Film von 1938, in dem Gustaf Gründgens die Hauptrolle spielte und für den Theo Mackeben Hits wie »Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da« und »Du hast Glück bei den Frau’n, Bel Ami« schrieb. Der Ausbruch, auf den Deutschland allerdings 1933 zusteuerte, war weit mehr als ein Ausbruch von übersteigertem Nationalismus, verbunden mit dem Verlust elementarer Bürgerrechte und einer totalitären Übernahme des Staats, die sich auf alle Facetten des gesellschaftlichen wie kulturellen Lebens auswirkte. Er signalisierte den Beginn eines verbrecherischen Systems, das vom Großteil der Bevölkerung getragen wurde und dem Millionen Menschen zum Opfer fielen.
Der Jazz spielt in den Jahren des Nationalsozialismus durchaus eine Rolle, anhand seiner Rezeption lässt sich gut erkennen, als wie gefährlich die politische Sprengkraft eingeschätzt wurde, die in seiner Emotionalität und Individualitätsästhetik steckte. Wobei den Machthabern zugleich klar war, dass eine Musikrichtung, die so populär war, nicht einfach beiseite gedrängt werden konnte, sondern dass man versuchen musste, sie zu kontrollieren und für die eigenen Zwecke einzusetzen.
Seit den 1920er Jahren unterschied man Musiker in Tingler, also Künstler und Bands, die jedes beliebige Engagement annehmen mussten, und jene, die das nicht nötig hatten, weil sie sich einen Namen gemacht hatten und/oder einfach gut genug waren, sich auszusuchen, wo sie auftraten. Eric Borchard, der bereits mit seinen Aufnahmen von 1924 beeindruckt hatte, sei, wie der Trompeter Fred Clement berichtet, kein Tingler gewesen, »obwohl er viele Engagements annahm, die seinem Können nicht angemessen waren«.93 Nach der Entlassung aus dem Gefängnis, wo er zehn Monate für die fahrlässige Tötung einer Freundin verbracht hatte, stellte Borchard eine neue Band zusammen und spielte im September 1932 »Some of These Days« ein, einen amerikanischen Hit, den die Revuesängerin Sophie Tucker bekannt gemacht hatte. Borchard singt das Thema und das daran anschließende Scatsolo. Es folgt ein Chorus des Saxophonsatzes, dann einer, in dem Blech und Saxophone sich abwechseln, ein Chorus, der ein anscheinend ursprünglich improvisiertes Solo für den gesamten Saxophonsatz ausschreibt – wobei die Melodie zwar Anklänge an typische Armstrong-Soli enthält, allerdings nicht der Armstrong-Aufnahme des Stücks entstammt, so dass es sich gut und gerne um eine künstlerische Annäherung des Arrangeurs an Armstrongs Stil handeln mag –, schließlich ein swingender vollhändiger Ensemblechorus einschließlich dynamisch zurückgesetzter Bridge. Außer der ungewöhnlichen Scateinlage kein Solo, aber von vorn bis hinten ein antreibendes Ensemblearrangement. Andere Titel Borchards aus den Jahren vor seinem Tod 1934 bestätigen den Eindruck, der »Bugle Call Rag« etwa oder »Georgia on My Mind«: Das Ensemble hatte ein entspanntes Zusammenspiel entwickelt; der Rhythmusgruppe gelang ein vorwärts gerichteter Schub; die Arrangements bestanden keinesfalls bloß aus thematischen Wiederholungen, sondern bauten Spannungswechsel ein, machten auch von der besonderen Instrumentierung der Bigband Gebrauch, und Borchards Vokalinterpretationen der Schlager zeigten, dass er die Entwicklung des amerikanischen Jazz durchaus verfolgte, ob durch Schallplatten im Original oder mittelbar beispielsweise durch die britische Rezeption desselben.
Am 14. September 1930 führte die Wahl zum 5. Reichstag der Weimarer Republik dazu, dass die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 107 Sitze erhielt und damit nach der SPD zweitstärkste Fraktion im Parlament war. Schon seit Januar war die NSDAP in Thüringen Teil der Regierungskoalition und stellte dort mit Wilhelm Frick den Minister für Inneres und Staatsbildung. Frick hatte sich bereits im Reichstag mit antisemitischen und rassistischen Reden hervorgetan und handelte nun auch als Minister entsprechend, etwa indem er einen Lehrstuhl für Sozialanthropologie einrichtete, der sich vor allem mit den nationalsozialistischen Vorstellungen von Rassentheorien beschäftigen sollte. Frick verbot im Dezember 1930 Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues in Thüringen als Schullektüre und »säuberte« öffentliche Sammlungen von den Werken von Künstlern wie Paul Klee, Oskar Kokoschka und Emil Nolde. Vom September 1930 schließlich datiert Fricks Erlass »Wider die Negerkultur für deutsches Volkstum«, in dem er konkret gegen den Jazz wetterte. Ein Verbot war dies noch nicht, und die Auswirkungen solchen Denkens kamen auch noch nicht wirklich auf den Varietébühnen an.94 Doch Reichskanzler Franz von Papen übernahm Fricks Argumentation und weitete diese 1932 in ein Auftrittsverbot für schwarze Musiker aus, das allerdings eine ganze Weile noch mit Sondergenehmigungen umgangen werden konnte.95
Musik war in diesen Jahren nach wie vor gefragt, die Infrastruktur aber, durch die die Menschen an die Musik kommen konnten, brach nach und nach zusammen. Viele Lokale mussten schließen; etliche der noch jungen Plattenfirmen gingen in Konkurs oder mussten mit größeren fusionieren; viele der Orchester, die zuvor Wochen- oder Monatsengagements in großen Hotels oder Ballsälen hatten, gingen auf Tournee durch die Provinz. In Berlin waren nach wie vor große Orchester zu hören, nur fand die große Menge an Musikern in der Hauptstadt zu Hause nicht mehr genügend Auftrittsmöglichkeiten.
Bei den Reichstagswahlen vom 31. Juli 1932 überholte die NSDAP die Sozialdemokraten und erreichte 37,3 Prozent. Die unklaren Mehrheitsverhältnisse führten zu einer Neuwahl am 6. November desselben Jahres, bei der die Nationalsozialisten zwar mehr als vier Prozent verloren, eine stabile Regierungsbildung aber trotzdem nicht möglich war. Reichspräsident Hindenburg ernannte für kurze Zeit Kurt von Schleicher zum Reichskanzler, und am 30. Januar 1933 schließlich Adolf Hitler. Am 1. Februar wurde der Reichstag aufgelöst, Neuwahlen wurden für den 5. März angesetzt. In dieser letzten Reichstagswahl der Weimarer Republik errang die NSDAP 43,9 Prozent; mithilfe des Ermächtigungsgesetzes vom 23. März 1933 war der Weg in die nationalsozialistische Diktatur der nächsten zwölf Jahre geebnet.
Erste Maßnahmen gegen den Jazz
Schon in den 1920er Jahren hatte es offene und unterschwellige Ablehnung der Jazzmusik gegeben. Konservative Kreise waren befremdet und sahen im Jazz den Inbegriff eines ausschweifenden und ungezügelten Lebens. Die neue Musik war vielen suspekt, und die Gründe dafür waren vielfältig. Rassismus spielte natürlich eine Rolle, die grundsätzliche Furcht vor Veränderung kultureller Werte, die wirtschaftliche Situation, die alle gesellschaftlichen Schichten in Unsicherheit stürzte, die politische Agitation von rechts, die in einer Konzentration auf eigene »Werte«, aufs Nationale den Ausweg sah und in der zunehmenden Internationalisierung eine drohende Gefahr. Der Jazz war in seiner Fremdheit und in der gleichzeitigen Faszination, die er bei so vielen in der Bevölkerung auslöste, ein exzellentes Feindbild. Er war Hassobjekt, Projektionsfläche für die klischeehafte Ablehnung von allem Nichtdeutschen und Sündenbock für den generellen »Verfall der Sitten«.
Aktionen gegen den Jazz, die es bereits vor der Machtübernahme durch die Nazis gegeben hatte, nahmen also schnell zu. Anfangs setzte das Regime auf Marschmusik, von der es annahm, dass sie ähnlich mitreißend wirken könnte. Aufsätze in nationalsozialistischen Zeitungen, mehr und mehr aber auch in zuvor unbescholtenen Kulturzeitschriften lieferten feuilletonistische, pseudo-kulturwissenschaftliche oder -musikwissenschaftliche Begründungen, warum der Jazz, oder wie es gerne hieß, die »verjazzte und verjudete« Tanzmusik im neuen Zeitalter nicht mehr akzeptabel sei.96 Im Melos , einer der wichtigsten Musikzeitschriften in Deutschland, war schon 1930 Jazz als afro-amerikanische und zugleich als eine von Juden propagierte Musik verfemt worden. Da hieß es etwa: »Die Grundlagen des Jazz sind die Synkopen und rhythmischen Akzente der Neger; ihre Modernisierung und gegenwärtige Form ist das Werk von Juden, zumeist von New Yorker Tin-Pan-Alley-Juden. Jazz ist Negermusik, gesehen durch die Augen dieser Juden.«97
Читать дальше