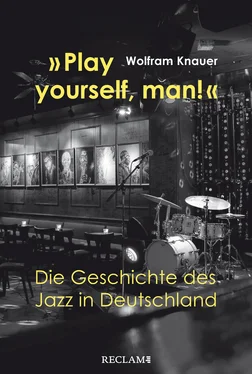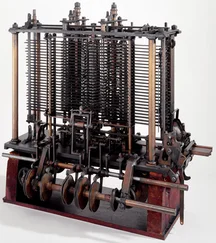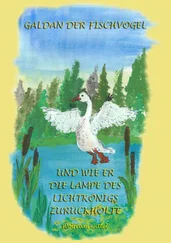Die Absurdität der nationalsozialistischen Versuche, den Jazz einzudämmen, lässt sich am schlüssigsten anhand der Geschichten zeigen, wie findige Musiker allerorten die Kontrolleure der Reichsmusikkammer dadurch foppten, dass sie den amerikanischen Standards einfach deutsche Titel gaben: Aus dem »Tiger Rag« wurde »Schwarzer Panther« oder »Löwenjagd im Taunus«, aus »Dinah« das »Moosröschen« oder aus »Oh Joseph, Joseph« der »Große Lärm vom Kudamm«.124 Wenn die Kontrolleure sich allein durch Titeländerungen hinters Licht führen ließen, weil sie das alles musikalisch eh nicht beurteilen konnten, wie stand es dann tatsächlich mit dem gelungenen Kampf gegen Jazz, »undeutsche Musik« oder »verjudete Negerinstrumente«?
Auch hier war es, wie bereits angedeutet, mit einem konsequenten und wirkungsvollen Verbot nicht weit her. Man kann sich den Widerspruch zwischen verbaler Ächtung und Praxis im Höreindruck auch ganz konkret vor Ohren halten, wenn man sich Musik- und Revuefilme der Zeit ansieht: Wann immer darin eine Tanzkapelle zu sehen ist, wird diese wahrscheinlich einen Saxophonsatz beinhalten, es werden die Blechbläser mit Dämpfern arbeiten, der Pianist wird swingende Anleihen bei Teddy Wilson machen, und der Bassist sein Instrument betont und fast perkussiv zupfen, um unter dem Orchester hörbar zu bleiben. 1935 wurde der Komponist Hans Felix Husadel ins Luftwaffenministerium berufen und erhielt den Auftrag, die Musik der Luftwaffe neu zu organisieren. Eine seiner Neuerungen war die Einführung eines fünfstimmigen Saxophonsatzes, der bald auch von anderen Abteilungen übernommen wurde. Musik, scheint es, war viel zu flüchtig, um nachhaltig verbannt werden zu können.
Was verboten werden konnte, waren etwa Schallplattenaufnahmen oder Notenveröffentlichungen jüdischer Komponisten, zu denen im Jazzbereich ja auch George Gershwin, Irving Berlin oder Jerome Kern gehörten.125 Doch letzten Endes ging es selbst mit diesen Verboten nicht so einfach, wie Peter Köhler recherchierte: »Um die Exportchancen der deutschen Schallplatten- und Filmindustrie nicht zu gefährden, sahen sich die Nazis gezwungen, einmal geschlossene Verträge zu respektieren und einzuhalten. So kam es, daß bis in den Krieg hinein eine große Zahl amerikanischer Jazzschallplatten in jedem größeren Musikgeschäft zu haben [war].«126 Und dass die Jazzliebe nicht nur im Verborgenen beziehungsweise in einer Art alternativen Untergrundszene vorherrschte, ist an zwei später gern zitierten Beispielen festzumachen: einem Foto, das den Oberleutnant der Luftwaffe und lebenslangen Jazzfan Dietrich Schulz- Köhn(geb. 1912) Anfang der 1940er Jahre im besetzten Paris in Wehrmachtsuniform Arm in Arm mit Django Reinhardt und Mitgliedern seiner Band zeigt, sowie den Mitteilungen , einer vom selben Schulz-Köhn, Gerd Pick und Hans Blüthner herausgegebenen Postille, die ab 1943 hektographiert in wenigen Exemplaren unter Jazzfreunden in Deutschland herumgeschickt wurde.
Schulz-Köhn hatte bereits als Gymnasiast begonnen, Schallplatten zu sammeln, war 1932 Mitglied der Jazzklasse an Dr. Hoch’s Konservatorium in Frankfurt gewesen, entschied sich dann aber lieber für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. Er pries sich selbst als Gründer (oder Mitgründer) von drei »Rhythmusclubs« in Berlin, Königsberg und Magdeburg; und er arbeitete seit 1934 neben dem Studium für die Deutsche Grammophon, für die er den Brunswick-Katalog mit Jazz- und Swing-Schallplatten betreute. 1935 machte er seinen Abschluss als Diplomvolkswirt und promovierte 1939 über Die Schallplatte auf dem Weltmarkt . Außerdem schrieb er regelmäßig Artikel, etwa für die schwedische Jazz-Zeitschrift Orkester Journalen . 1933 war Schulz-Köhn bereits der SA beigetreten, 1938 wurde er Mitglied in der NSDAP; im Krieg brachte es der Soldat schnell zum Oberleutnant, während er sich auch als Komponist der Lieder »Wer kennt die Soldaten im grauen Kleid?« und »Wir tragen nicht Schmuck und nicht Orden schwer« hervortat, die 1941 in der Liedersammlung Volk in Waffen veröffentlicht wurden. Als Offizier der Luftwaffe gehörte er zu den Besatzungstruppen in Frankreich, wo 1942 eben jenes berühmte Foto entstand, auf dem er in Uniform neben Django Reinhardt zu sehen ist. Seine Jazz-Interessen, sagte Schulz-Köhn später, hätten ihm in seiner Militärlaufbahn nicht geschadet. Das Foto, auf dem außerdem noch vier schwarze Musiker und ein französischer Jude, der sich verstecken musste, zu sehen sind, kommentierte Schulz-Köhn später so: »Erstaunlich. Hier bin ich, in Uniform, mit einem Zigeuner, vier Negern und einem Juden.« 127
Nach dem Krieg betonte Schulz-Köhn, dass seine Aktivitäten für den Jazz doch irgendwie auch gegen das System gerichtet gewesen seien, und gerade seine Mitwirkung an den Mitteilungen lässt sich durchaus so verstehen. Im Vorwort zur ersten Ausgabe spricht er davon, dass Swing- oder Hot-Musik doch genauso eine Berechtigung hätten wie die Kompositionen von Debussy und Tschaikowsky oder die Novellen von Balzac oder Stendhal. Und er hegt die Hoffnung, dass es nach dem Krieg – und implizit gemeint ist dabei: nach dem deutschen Sieg – möglich sein sollte, eine Art europäisches Netzwerk der Hot-Clubs zu gründen. Ein wenig schizophren klingt das alles schon. Nach dem Krieg landete Schulz-Köhn in französischer Gefangenschaft, in der er mit anderen Interessierten einen kleinen Hot-Club gründete und Vorträge über die Musik hielt. Nachdem er 1947 freikam, arbeitete er für die Decca, war regelmäßig als »Dr. Jazz« im Westdeutschen Rundfunk zu hören und setzte sich für seinen Traum einer Vernetzung der Jazzszene – jetzt zumindest in Westdeutschland – ein.
Die Bandbreite zwischen dem, was offiziell verpönt und über was gehetzt wurde, und dem, was nach wie vor möglich war (wenn auch mehr und mehr im Verborgen, im Subkulturellen – wenn man diesen Begriff für die Nazizeit überhaupt anwenden mag), ist also bemerkenswert groß. Werfen wir im Folgenden daher einen Blick auf die Musik selbst und auf die Wahrnehmung dessen, was diese Musik für die Fans bedeutete.
Von »White Jazz« bis »Delphi Fox«
Der Geiger (nebenbei Sänger und Trompeter) Heinz Wehner(geb. 1908) hatte seit 1925 eine kleine Tanzkapelle, mit der er in und um Hannover, aber auch im Bergischen Land oder auf Norderney auftrat. Über die Jahre erweiterte er die Band zu einem Orchester und konnte mit dem Posaunisten Willy Berking und dem Saxophonisten und Klarinettisten Herbert Müller zwei Musiker gewinnen, die sich neben der Satzarbeit auch solistisch einsetzen ließen. 1934 ging er nach Berlin und machte sich dort schnell einen Namen, auch deshalb, weil es seiner Band gelang, die Arrangements der weißen amerikanischen Bands, die ihm und vielen anderen deutschen Orchestern als Vorbild dienten, perfekt nachzuspielen. Ein Beispiel ist der Titel »White Jazz« aus dem Jahr 1935, den Wehner im originalen Arrangement sowie in der Soloabfolge an die Aufnahme des Casa Loma Orchestra von 1931 anlehnte. Das Casa Loma Orchestra war die vielleicht einflussreichste weiße amerikanische Band, bevor Benny Goodman 1935 seinen Durchbruch hatte. Sie verdankte ihren Erfolg nicht so sehr den Solisten, sondern vielmehr den effektvollen Arrangements Gene Giffords, dem es gelang, Komplexität mit Leichtigkeit zu verbinden und so selbst den eindeutig probe-intensivsten Titeln eine improvisatorische Qualität zu verleihen. Casa Loma fand bei vielen europäischen Bands Bewunderer, auch deshalb, weil die Arrangements versprachen, jene Leichtigkeit, mit der sich europäische Ensembles nach wie vor schwer taten, allein durch die in der Orchestrierung vorgegebenen Klangwechsel zumindest ansatzweise zu erreichen.
Mit »White Jazz« also – der Titel ist übrigens eher als Wortspiel denn als kulturpolitische Botschaft zu verstehen – lässt sich, da Wehner entweder Giffords Arrangement vorlag oder aber einer seiner Musiker es wirklich eins zu eins transkribiert hatte, der direkte Vergleich gut anstellen. Insbesondere Willy Berkings Posaunensolo muss sich in seiner Expressivität nicht hinter dem im Original von Pee Wee Hunt gespielten Solo verstecken. Die Unsicherheit mit dem Idiom hört man dann, wenn sich der Schlagzeuger gerade ein wenig zu viel Mühe gibt oder wenn – insbesondere gegen Schluss – die Rifffiguren der Bläser nicht flüssig, sondern von Noten abgespielt wirken. Und doch klang es für zeitgenössische Ohren offenbar anders, jedenfalls wurde Wehner gerade dafür gelobt, dass alles »wie frei improvisiert« klinge – »und doch ist hier höchste Disziplin oberstes Gesetz!«128 Wenn man sich allerdings einige der weitaus holprigeren Interpretationen anderer Bands der Zeit vor Augen hält oder Aufnahmen, die deutlich machen, dass Kollegen Wehners die viel statischere rhythmische Auffassung der 1920er Jahre noch nicht hinter sich gelassen hatten, dann wird verständlich, warum Wehner schnell breiten Erfolg hatte. Im selben Monat nahm übrigens auch die Band von James Kok »White Jazz« auf, was einen Vergleich zweier deutscher Kapellen erlaubt. Die Ensemblepartien sind bei Kok weit unsauberer; mit dem Klarinettisten und Saxophonisten Erhard Bauschke und dem Pianisten Fritz Schulz-Reichel hatte er zwei großartige Solisten im Ensemble. Auch Kok scheitert allerdings am Riffchorus des Schlusses, der nirgends nach vorne drängt, sondern seltsam statisch und von Noten abgelesen wirkt.
Читать дальше