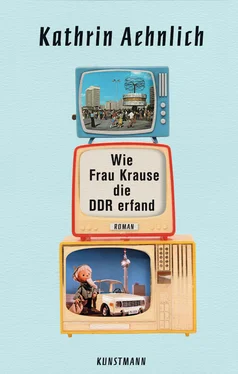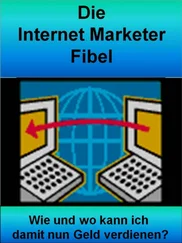Jetzt türmten sich vor Isabella buntbedruckte Becher. Sie war sicher, dass sich die Folie ohne Anstrengung von dem Deckeln lösen lassen würde.
Es muss ein Ende haben, dachte Isabella. Wollte sie diese Bühne mit Würde verlassen, musste sie selbst die Initiative ergreifen. Es galt, sich aus eigenem Willen von diesem Casting zu verabschieden. Wenn sie sich schon blamierte, dann wenigstens mit Absicht. Isabella verzog ihr Gesicht zu einem dümmlichen Lächeln und schob den Einkaufswagen auf die Kamera zu.
»Ooch isch habbe misch in meim Läbn endschiedn! Un föhr meine Familschä endscheide isch gleisch midd.«
»Wunderbar«, schrie der Assistent mit Tränen in den Augen. »Wunderbar!«
»Du bist aus dem Ooo … oh Entschuldigung, aus den neuen Bundesländern?«, fragte die Aufnahmeleiterin.
»Sag ruhig Osten«, sagte Isabella, »wir haben immer Osten gesagt.«
»Kennst du viele Leute?«, fragte die Aufnahmeleiterin. »Ich meine im … Osten?«
»Zwangsläufig!«, sagte Isabella.
»Wir hätten da vielleicht einen Auftrag für dich. Kannst du ein Stündchen warten? Der Chef ist noch auf dem Rückflug von einer Besprechung in Zürich. Die Sekretärin sagt dir dann Bescheid!«
»Gut«, sagte Isabella und dachte, schlimmer kann es nicht werden. »Ich gehe einen Kaffee trinken!«
Als sie den Laden verließ, kam ihr die nächste Casting-Kandidatin entgegen: eine junge Blondine auf High Heels. Und Isabella hörte, wie der Assistent anerkennend pfiff.
Der einzige Triumph, den Isabella hatte, war die Gewissheit, dass so keine Mutter auszusehen hatte, zumindest nicht im deutschen Fernsehen. Die Blondine hätte für Autos, Cognac oder sich auf einem Fell räkelnd für Kaminöfen werben können, aber nicht für die gesunde Ernährung ihrer Familie. Eine Mutter war eine Beschützerin, die jederzeit ausstrahlen musste, dass sie in der Lage war, sich um ihr Kind zu kümmern. Das war auch schon in Isabellas Kindheit so gewesen.
»Das ist deine Mutter?«, hatte ein Schulkamerad entsetzt gerufen, als Isabella von ihrer Mutter von der Schule abgeholt worden war. Eine treusorgende Mutter trug keinen breitkrempigen Hut und schminkte sich nicht. Schuld an dieser »Verkleidung«, wie es die Großmutter nannte, war Isabellas Vater, der Hallodri, der wünschte, dass seine Frau eine Dame wäre. Er entstammte einer Tanzschulen-Dynastie, deren verblichener Werbespruch auch noch in Isabellas Kindheit auf einem Schild an der Fassade zu lesen war: »Tanzschule Kaiser – Bei uns lernen Könige tanzen!«
In der DDR hatte sich diese Zielgruppe etwas verschoben. Statt auf Königen lag der Fokus vor allem auf pubertierenden Jugendlichen, die größtenteils nicht freiwillig kamen, sondern von ihren Eltern gezwungen wurden, einen Kurs zu belegen.
Besitzer der Tanzschule war Theodor Kaiser, der schöne Theo, eine stattliche Erscheinung, der allerdings in Gegenwart seiner Frau fast hager wirkte. Er nannte die füllige Frau Magda »meine Elfe«, was bei Isabella Zweifel an den Bildern in ihrem Märchenbuch aufkommen ließ, auf denen Elfen und Feen schwebende Wesen waren. Im Gegensatz zur schwermütig wirkenden Frau Magda war der schöne Theo immer heiter und wollte, dass alle Menschen um ihn herum Spaß hatten. Sein Sohn, der Hallodri, hatte dieses Wesen geerbt, und so wurde im Hause Kaiser nicht nur getanzt, sondern viel gelacht, gesungen und selbstverständlich auch getrunken. Vielleicht war es die Unbeschwertheit, die Isabella dazu verleitet hatte, sich nach einem Beruf zu sehnen, für den sie wahrscheinlich nicht bestimmt war. Und auch Frau Magda hatte zu der Fehlentscheidung beigetragen, indem sie nie einen Zweifel über die Vererbung ihrer »Theater-Gene« aufkommen ließ.
Und immer häufiger stellte sich Isabella die Frage, ob sie als Schuhverkäuferin nicht glücklicher geworden wäre? Aber wer träumte mit sechzehn Jahren schon davon, Schuhverkäuferin zu werden?
Mittenhinein in diesen Grundsatzgedanken klingelte ihr Telefon. »Der Chief wäre jetzt da«, sagte die Sekretärin, Isabella solle sich beeilen! Sie hatte tatsächlich Chief gesagt, und Isabella überlegte, ob sie, statt ihm die Hand zu reichen, salutieren sollte.
Der Einkaufswagen mit den Joghurtbechern stand noch immer neben der Ladentafel. Isabella wartete, bis die Sekretärin kam und sie in den Versammlungsraum begleitete. »Isabella Krause«, sagte Isabella Krause und nickte drei Männern zu, die bereits am Tisch saßen und sich unterhielten. Sie blickten kurz auf und redeten dann weiter. Die Firma war größer, als es der Eingang des Molkereiladens vermuten ließ. Nüchterne Backsteinwände, sichtbar verlegte Stromleitungen. Alles war auf das Nötigste reduziert und hatte den aufpolierten Charme einer alten Fabrik.
Der Chef oder besser der Chief betrat den Raum, begrüßte die drei Männer freundschaftlich und rief dann: »Sie sind sicher Frau Krause?«, und als Isabella nickte, »hat Ihnen denn niemand Bescheid gegeben, dass Sie später kommen sollen?«. Er gab ihr einen Klaps auf die Schulter. »Wir möchten zuerst einige wichtige Dinge besprechen, dazu benötigen wir Sie noch nicht.«
»Vor allem die Honorare«, rief einer der drei Männer.
»Ich kann mich hier einfach still hinsetzen«, sagte Isabella. Sie bemerkte, wie der Mann zusammenzuckte und dem Chief ein Zeichen gab.
»Besser ist, Sie setzen sich so lange in die Küche«, sagte der Chief, »dort steht auch eine Kaffeemaschine, Sie können sich einen Kaffee nehmen, und wir rufen Sie dann.«
Da saß sie nun mit einer Tasse lauwarmem Kaffee. Es hätte nur noch gefehlt, er hätte gesagt, Sie können sich eine Tasse Bohnenkaffee nehmen. Isabella kam sich vor wie ein Kind, das zwar adoptiert worden war, aber trotzdem auf Abstand gehalten wurde. Zuerst kam die Bescherung der eigenen Kinder, erst dann folgten die anderen.
Isabella stand am Küchenfenster und blickte nach draußen, auf eine ungepflegte Grünfläche. War hier schon Sperrgebiet gewesen?
Bei ihrem ersten Berlin-Besuch hatte Isabella mit ihrer Schulklasse auch das Brandenburger Tor besucht. Weit vor dem Tor gab es einen halbhohen Metallzaun, dahinter, in sichtbarer Entfernung, standen Soldaten mit Maschinenpistolen. Sie schützten eine Betonfläche, die links und rechts von Rasen und Blumenkübeln gesäumt war. Isabella und ihre Schulfreundinnen hatten ihnen zugewinkt und Grimassen gezogen, aber die Gesichter der Soldaten waren wie versteinert geblieben. Nicht einmal ein Zwinkern war zu erkennen gewesen.
Niemand wunderte sich, dass die Soldaten nicht in Richtung des Brandenburger Tores guckten, durch das der Feind kommen und angreifen würde.
Was war das für eine Grenze gewesen, an der die Soldaten das Gesicht dem eigenen Volk zuwandten und dem Feind den Rücken?
Es dauerte fast eine Stunde, bis Isabella wieder ins Zimmer gerufen wurde. Jetzt waren zehn Personen um den Tisch versammelt, die ihr alle erwartungsvoll entgegensahen.
»Ja, Frau Krause, schön, dass Sie da sind!«, sagte der Chief lauter als nötig und machte eine Geste, als erwartete er von Isabella, dass sie sich verbeugte.
Isabella fühlte, wie sie sich verkrampfte.
»Aber setzen Sie sich doch. Wollen Sie einen Kaffee?«
»Ich hatte schon zwei«, sagte Isabella.
Der Chief wirkte wie aufgezogen. Er wippte unruhig auf seinem Stuhl hin und her und vermittelte den Eindruck, als hinge er an einem Gummiband und würde in wenigen Minuten nach oben gezogen, um zurück nach Zürich zu fliegen.
»Darf ich Ihnen Ihre Kollegen vorstellen: Herrn Fuchs aus Köln, er ist der Autor und, wie der Name sagt, ein Fuchs.« Der Chief lachte meckernd über seinen Witz, während der Fuchs eine abwiegelnde Geste machte, die weder auf Zustimmung noch auf Ablehnung schließen ließ. Der Fuchs hatte passend zu seinem Namen rote Haare. Der Chief setzte fort: »Das ist Frau Glaubitz, die auch für das Casting zuständig ist. Herr Becker, Herr Krake …« Die Namen von Kameramännern, Tonassistenten, Cuttern, Praktikanten zogen an Isabella vorüber. Sie nickte immer nur kurz, als müsse sie die Personalien bestätigen.
Читать дальше