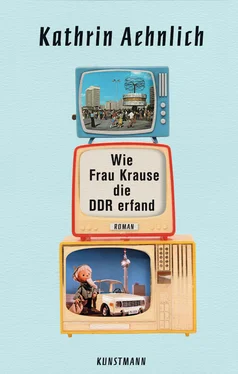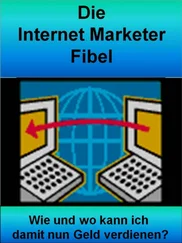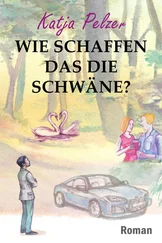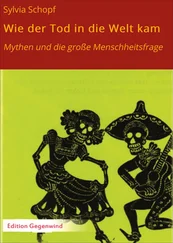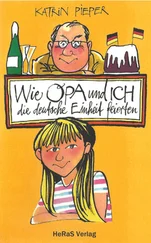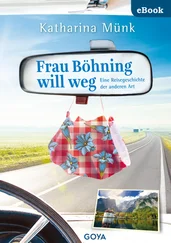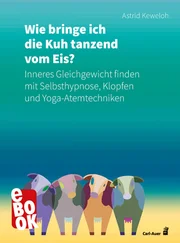Isabella lief in Richtung Alexanderplatz. Eine Touristengruppe marschierte hinter einer Stadtführerin über den Platz. An den zahlreichen Verkaufsständen wurden Souvenirs angeboten. Das Land war reduziert auf Rotarmistenmützen, Nationalmannschaft-Trikots und Ampelmännchen. Der Osten war über die Jahrzehnte hinweg in Mode gekommen. Aber jetzt im November wirkte der Platz noch trostloser, als er es ohnehin schon war. Das Wasser aus dem Brunnen der Völkerfreundschaft war abgelassen, niemand saß auf dem Rand. Auch das Rondell unter der Weltzeituhr war leer. Früher hatte Isabella sich hier mit ihren Freunden getroffen und sich die Wartezeit mit dem Lesen der Städtenamen verkürzt: Sydney, Casablanca, Kinshasa. Städte, die von Ostberlin aus gesehen jenseits jeder Zeitzone lagen. Doch sie waren Isabella durch das bloße Betrachten der Uhrzeit näher gerückt, und sie hatte sich vorgestellt, sie würde in London auf einen Freund warten oder in New York, je nachdem unter welchem Städtenamen sie gerade stand. Die Uhr hatte ihr das Gefühl gegeben, dieser Platz wäre der Mittelpunkt der Welt. Heute schämte sie sich für ihre Naivität, denn war es nicht ein unglaublicher Zynismus gewesen, mitten hinein in das eingemauerte Land eine Weltzeituhr zu bauen?
Wie immer wehte auf dem Platz ein scharfer Wind. »Hier zieht’s wie Hechtsuppe!«, hätte die Großmutter gesagt. Durch den Abriss der historischen Bebauung waren Windkanäle entstanden, die sich durch die Neubauten noch verstärkt hatten. Alles sollte anders werden. Alles musste anders werden. Während ihrer Schulzeit war Isabella mit ihrer Klasse nach Berlin gefahren, um auf dem Alexanderplatz DAS Wunderwerk sozialistischer Baukunst zu bestaunen: den Fernsehturm. Er war das höchste Gebäude im ganzen Land. Und ausnahmsweise wurde zu diesem Vergleich das gesamte Deutschland herangezogen, denn der Fernsehturm überragte mit seinen 365 Metern auch alle Gebäude des Klassenfeindes. 365 Meter, nie würde Isabella die Zahl vergessen, für jeden Tag des Jahres einen Meter. So hatte es Walter Ulbricht vor dem Bau angeordnet, damit es sich alle Kinder im Land merken konnten.
Jetzt war nichts mehr zu spüren von den ehemaligen Visionen. Der Platz wirkte wie ein zu oft gewaschenes Kleidungsstück, dem auch mit neuen Knöpfen kein neuer Glanz zu geben war. Sie konnte sich nicht erklären, weshalb sie ihn einmal schön gefunden hatte.
Vielleicht war es die Vorfreude gewesen. Die Vorfreude auf die Abende, denn für Isabellas Berlin-Reisen gab es damals nur einen Grund: das Theater. Sie kannte die Spielpläne vom Deutschen Theater, der Volksbühne und dem Maxim Gorki Theater auswendig. Ob Barlachs »Der Blaue Boll«, Horváths »Glaube, Liebe, Hoffnung« oder Heiner Müllers »Hamlet«, das Theater war für Isabella der wahre Glanz von Berlin. Es war eine Welt, nach der sie süchtig war.
Das Theater war eine Mitgift der anderen Großmutter gewesen. Magda Kaiser, die Staatsschauspielerin, die bei Todesstrafe nicht Großmutter genannt werden wollte und erst recht nicht Oma. »Welch Verhöhnung einer Dame!«
Isabella lief durch Berlin und versuchte, an Naturjoghurt zu denken. Sie musste sich in eine gesundheitsbewusste Mutter verwandeln. »Für meine Familie nur das Beste!« Sie stellte sich einen gedeckten Frühstückstisch vor, an dem ein zeitungslesender Mann und drei ordentlich gekämmte Halbwüchsige saßen, denen sie lächelnd die Schälchen mit dem Joghurt reichte. Sie prüfte ihr liebevolles Muttergesicht in einem Schaufenster. Obwohl sie mit ihren fast fünfzig Jahren jünger wirkte und ihre Agentur bei dem Geburtsdatum geschummelt hatte, würde sich Isabella nicht mehr lange im Mutter-Fach halten können. »Großmütter sind das Ende der Karriere« lautete einer von Frau Magdas Grundsätzen.
Die Studioadresse lag nicht weit vom Alexanderplatz entfernt. Es war ein Haus mit großer Toreinfahrt. Ein Treppenaufgang links, ein Treppenaufgang rechts. Durch die geöffnete Hoftür sah Isabella das Hinterhaus. Früher hatten ihr diese gepflasterten Innenhöfe gefallen. Jetzt erschien ihr alles zu eng. Jeder konnte jeden vom Balkon aus beobachten. Es war eine Nähe, die Isabella erdrückt hätte.
Neben den Briefkästen hing ein mit Klebestreifen befestigtes Schild:
»Global-Movie-Production«. Der Pfeil zeigte zurück auf die Straße. Sie hatte es übersehen. »Molkerei Max Barthold« stand über dem Schaufenster. Zwischen der Scheibe und der wahrscheinlich vor Jahren heruntergelassenen Jalousie lagen tote Fliegen.
Isabella stieg die drei Stufen zur Ladentür nach oben. Vorsichtig drückte sie die Türklinke und zuckte unter der lauten Ladenglocke zusammen.
Von irgendwo rief eine Stimme: »Hi!«
Und Isabella antwortete: »Hi!«
»Stell dich schon mal hin!«, rief die Stimme. »Wo ist denn schon wieder der Assistent?«
Hinter der Ladentafel tauchte eine Frau auf. »Ich habe gesagt, du sollst dich schon mal hinstellen!«
Verängstigt stellte sich Isabella an die Wand gegenüber der Kamera.
»Mehr nach rechts! Muss man euch denn alles sagen?«
Isabella lehnte mit dem Rücken an der Wand. Der Assistent kam. Er sah aus wie die meisten Kameraassistenten: Lederhosen, kurzgeschorene Haare, Ohrring. Um das rechte Handgelenk hatte er ein Tuch gebunden.
Er guckte in den Sucher, dann auf den Monitor und stöhnte leise auf, dann stellte er das Stativ tiefer.
»Reg mich nicht auf!«, schrie die Aufnahmeleiterin. »Reg mich nicht auf!«
Und zu Isabella gewandt: »Fang schon mal an: Name, Vorname, Profil, Profil, Hände, Hände!«
»Läuft!«, sagte der Assistent.
»Hast du nicht verstanden? Name, Vorname, Profil, Profil, Hände, Hände!«
Isabella war geneigt zu sagen: »Krause, Isabella, Profil, Profil, Hände, Hände.« Aber was ergab das für einen Sinn? In solchen Momenten war es klüger zu schweigen.
»Wohl zum ersten Mal beim Casting?« Die Aufnahmeleiterin drehte demonstrativ ihren Kopf nach links »Profil«, dann nach rechts »Profil« und wendete die Hände vor der Kamera. »Ist das so schwer?«
Isabella sagte brav ihren Namen, sah nach rechts auf die Wand, an der ein Werbeplakat hing: »Leben wie im Mittelalter«, dann auf die linke Wand: »Wild-Ost – So war die DDR wirklich«, und hielt ihre Hände der Kamera entgegen. Vielleicht hätte sie vorher zur Maniküre gehen sollen?
»Was soll denn das?«, fragte der Kameramann, der unbemerkt den Raum betreten hatte. »Sind wir hier in der Sesamstraße?«
Erst jetzt sah Isabella den Einkaufswagen mit den aufgetürmten Joghurtbechern.
Früher waren die Einkaufswagen niedriger gewesen. Früher! Jetzt waren sie so hoch, dass Isabella wie eine Zwergenmutter hinter dem Wagen stand und über die Becher spähte.
»Auch ich habe mich in meinem Leben entschieden! Und für meine Familie entscheide ich gleich mit!«
»Mal was anderes«, sagte der Assistent. »Und jetzt den Wagen auf die Kamera zuschieben!«
»Stopp!« rief der Kameramann. »Akku leer!«
»Noch mal!«
Wieder und wieder schob Isabella den Wagen auf die Kamera zu. Es gab kein Entrinnen. Sie war gefangen in einem Ostberliner Molkereigeschäft. Gekettet an einen Einkaufswagen mit Joghurtbecherattrappen.
Früher war Joghurt etwas Besonderes gewesen: Erdbeergeschmack, Pfirsichgeschmack, Pflaumengeschmack. Himbeergeschmack war immer zuerst vergriffen. Doch es gab noch eine Steigerung: Trinkjoghurt aus der Dreiecktüte. Eine weißliche Flüssigkeit, die in ihrer Konsistenz an geleimte Wandfarbe erinnerte. Als es die ersten Joghurttüten im volkseigenen Handel gab, hatten die Menschen angestanden. Und obwohl Isabella Joghurt nicht mochte, hatte sie gleich vor dem Laden eine Ecke von der Papptüte abgebissen und den Joghurt bis auf den letzten Tropfen durch die aufgeweichten Ränder gesaugt. Wer Joghurt aus der Tüte trank, war unbesiegbar.
Читать дальше