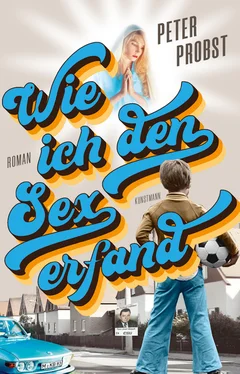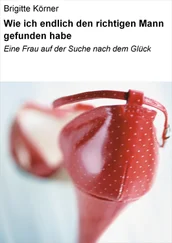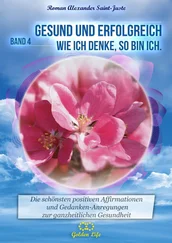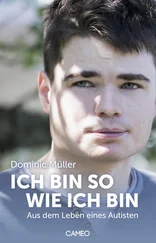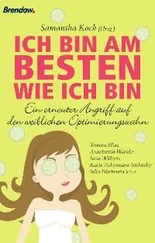Das schmälerte mein Vertrauen in Franz Josef Strauß nicht im Geringsten. Es war ja nicht seine Schuld, dass ich nicht so strebsam war wie mein unzüchtiger Großvater. Ich fragte ihn also, was ich tun könnte, um von meinen Klassenkameraden endlich bewundert zu werden. Wenn es einen Experten gab, der wusste, wie man es von ganz unten nach ganz oben schaffte, dann Strauß. Sein Vater war ein Metzger gewesen. Wahrscheinlich hatte er beim Ausfragen im Lateinbuch seines Sohnes Blutflecken hinterlassen und beim Elternsprechtag der Sozialkundelehrerin erklärt, wie man ein Schwein absticht. Aber das hatte einen Franz Josef Strauß auf seinem Weg zum besten deutschen Politiker nicht aufhalten können.
»Wenn du bewundert werden willst, musst du dir den steilsten Zahn von allen nehmen.«
»Was ist ein steiler Zahn?«
»Ein Mädel halt.«
»Ich will aber kein Mädel!«
Ich schrie so laut, dass meine Mutter ihren Platz vor dem ZDF-Magazin verließ, um zu schauen, ob ich schlecht geträumt hatte.
Kaum war sie weg, machte Strauß mit der Mädels-Nummer weiter.
»Du musst ja nicht Händchen halten, Gillitzer.«
»Und woran erkennen die anderen dann, dass ich mit einem gehe?«
»Lass dir was einfallen. Du bist schlau. Nicht die Wirklichkeit ist wichtig, sondern das, was die anderen dafür halten.«
Manchmal war Strauß schwer zu verstehen. Das kam daher, dass er unglaublich intelligent war. Er hatte sein Abitur mit 1.0 gemacht und war Stipendiat im Maximilianeum geworden. Da nahmen sie wirklich nur die »Allergescheitesten«, wie mein Vater wusste. Ich fragte Franz Josef Strauß, was er damit gemeint hatte, dass die Wirklichkeit nicht das Entscheidende war. Aber er mochte keine Erklärungen und verwandelte sich wieder in das Plakat, das stumm über mir an der Decke hing. Entweder man verstand ihn gleich oder man hatte Pech.
Was hatte er mir bloß sagen wollen? Nicht die Wirklichkeit ist wichtig . Ich grübelte die ganze Nacht. Als es schon wieder hell wurde, hatte ich die Antwort endlich gefunden.
Zum Schulbus gab es zwei Wege. Einen über Untermenzing und einen über Obermenzing. Das kam daher, dass wir in beiden Vierteln wohnten. Die Grenze verlief mitten durch unser Grundstück, das Gebäude gehörte noch zu Untermenzing, der Garten schon zum südlichen Nachbarstadtteil.
»Wenn euch jemand fragt«, riet unser Vater, »seid ihr besser Obermenzinger.«
Bertis Einwand, dass wir doch nicht im Garten wohnten, ließ er nicht gelten. Ich begriff zwar nicht, warum die Ober- den Untermenzingern überlegen sein sollten, folgte aber seinem Rat. Berti hingegen bezeichnete sich stur als Untermenzinger. Er hatte, nachdem viele Wissensfelder bereits durch mich belegt waren, in der Familie die Rolle des Geografieexperten übernommen. Er saß stundenlang vor dem großen Globus, den er zu seinem neunten Geburtstag bekommen hatte, oder blätterte in Dierckes Erdkundeatlas . So kannte er Städte, von denen ich noch nie gehört hatte. Beim Hauptstädte-Raten gewann er immer, seine Lieblinge waren Ulan-Bator und Kuala Lumpur. Geografische Schlampereien korrigierte er sofort, durch ihn war mir bewusst, dass es ein erheblicher Unterschied war, ob ich unser Grundstück durch das Eingangstor oder über den Gartenzaun verließ.
Der Untermenzinger Weg war der erlaubte. Er führte über eine kleine Straße vorbei an Mitte der Sechzigerjahre erbauten Einfamilien- und Reihenhäusern mit kahlen Vorgärten. Auf der Höhe eines Friedhofs erreichte er eine Ausfallstraße. Sie musste an einem Zebrastreifen überquert werden, der von eiligen Pendlern gern übersehen wurde. Es wurden aber nur selten Kinder an- und nur einmal eines totgefahren. Auf der anderen Straßenseite ging es weiter über eine Brücke und um ein Hauseck herum zu der vor einem Friseursalon gelegenen Haltestelle.
Der Obermenzinger Weg war der verbotene. Den nahm ich nur, wenn ich sicher sein konnte, dass meine Eltern mich nicht sahen. Verboten war er wegen des Maschendrahtzauns mit seinen spitzen Enden, die Einbrecher abhalten sollten. An ihnen zerriss man sich leicht die Hose. Das war so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren konnte. Ich besaß nur zwei lange Hosen, die gute Hose und die für jeden Tag . Mit der für jeden Tag ging ich normalerweise in die Schule, mit der guten in die Kirche. Wenn die Hose für jeden Tag mal wieder ein Loch hatte – meistens am Knie –, musste ich, bis Hertha sie geflickt hatte, die gute Hose tragen. Der verbotene Weg war nicht verboten, wenn ich in meiner kurzen Leder- oder der schwarzen Turnhose zum Bolzplatz ging.
Als ich an diesem Tag in der guten Hose über den Zaun stieg, weil der Reißverschluss der anderen geklemmt hatte, überlegte ich kurz, ob ich sie absichtlich zerreißen sollte. Vielleicht würde mein Vater mich dann in Unterhosen in die Schule schicken. Das wäre auch eine Methode gewesen, um Aufsehen zu erregen, aber mein Plan war besser. Alles ging gut. Auch der Bolzplatz war kein Problem, es gab keine Pfützen und keine Schafsscheiße, meine Sandalen und die weißen Frotteesocken blieben sauber. Gefährlich wurde es wieder im Wäldchen. Hier musste ich über Eisenschrott, Bauschutt, rostige Mopeds und Tierkadaver steigen. Alle im Viertel wussten, dass das Wäldchen bald für den Bau mehrerer Doppelhäuser abgeholzt werden würde, deswegen wurde es als Müllplatz verwendet.
Ein Bub aus Heidelberg war in den Winterferien in unser Viertel gekommen und hatte sich im Wäldchen beide Beine gebrochen. Wahrscheinlich hatte er sich geärgert, weil wir ihn immer als Preußen beschimpften, und nicht aufgepasst. Er war in eine Fallgrube gestürzt, die ein größerer Junge namens Andi gebaut hatte. Angeblich hatte er geplant, für sein Opfer Lösegeld zu erpressen. Als er seine gebrochenen Beine sah, hatte er doch lieber den Krankenwagen gerufen.
Ich machte einen Bogen um die Fallgrube und eine Ölpfütze und kam rechtzeitig an der Haltestelle an. Mein Klassenkamerad Hans-Jürgen, der schon auf mich wartete, sagte: »Servus, Gillitzer«, ich brachte nur ein Krächzen zustande. Obwohl ich das, was ich im Schulbus vorhatte, stundenlang im Kellerflur geübt hatte, war mir vor Lampenfieber schlecht. Als der Bus am Ende der Straße auftauchte, wäre ich am liebsten weggerannt wie einmal vor einer Lateinschulaufgabe, für die ich nicht gelernt hatte. Damals hatte ich mir auf dem Heimweg den Finger in den Rachen gesteckt und auf meine Sandalen gekotzt. Sie hatten so gestunken, dass meine Eltern keinen Augenblick daran zweifelten, dass ich mir den Magen verdorben hatte. Meine Mutter hatte mir Kamillentee gemacht, mein Vater mir den Ratschlag gegeben, beim Händewaschen auch auf die Fingerspitzen zu achten, die oft vergessen würden. Nach dem Kamillentee bekam ich eine Haferschleimsuppe, die so schleimig war, dass ich noch mal kotzte – diesmal ohne den Finger in den Rachen gesteckt zu haben.
Der Bus kam unaufhaltsam näher. Ich lasse den lieben Gott entscheiden, dachte ich, oder die Muttergottes oder Franz Josef Strauß, und steige nur ein, wenn er so hält, dass die Tür sich exakt vor mir öffnet. Das war noch nie passiert, ich musste mich in der Schülerhorde immer mit aller Kraft von der einen oder anderen Seite zur Tür drängen, um noch mitgenommen zu werden. Diesmal wurde ich zum ersten Mal auf geradem Weg in den Bus geschoben und hatte keine Chance zur Flucht in letzter Sekunde. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Ich musste es tun.
Ich hatte mich zuletzt trotz meiner Abneigung gegen das nördliche Nachbarviertel mit zwei Allachern angefreundet, die auf eine Realschule gingen, die vom Schulbus ebenfalls angefahren wurde. Obwohl, Freundschaft ist ein zu großes Wort, wir waren eher eine Zweckgemeinschaft. Die beiden besetzten für mich und Hans-Jürgen, der eine Schlüsselfigur in meinem Plan war, zuverlässig einen Platz in der hintersten Reihe. Dafür mussten wir mit ihnen Karten spielen. Während der Junge, den alle Hitler nannten, weil er mit Nachnamen Adolph hieß, mischte und gab und sein Freund Rudi einen unauffälligen Blick in mein Blatt warf, hielt ich Ausschau nach ihr .
Читать дальше