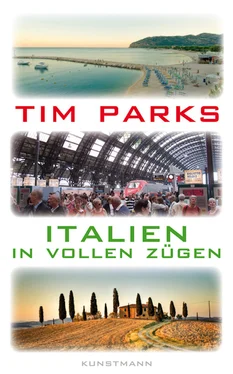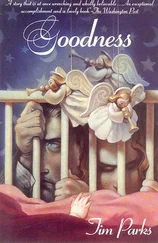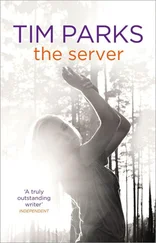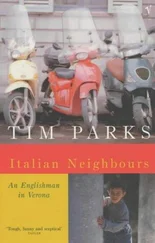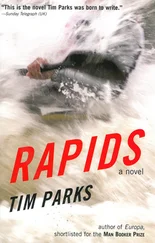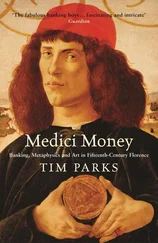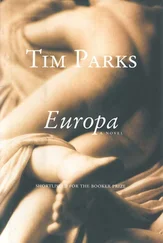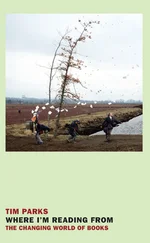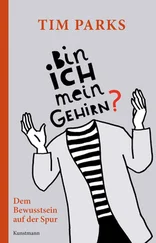Leider gibt es selbst morgens um Viertel nach sechs am Fahrkartenschalter eine unsäglich lange Schlange. Der ernsthafte Pendler braucht eine Dauerkarte. Aber welche Dauerkarte soll er nehmen? In England gibt es inzwischen unterschiedliche Karten für unterschiedliche Züge, die von unterschiedlichen Gesellschaften betrieben werden. Es herrschen der Wirrwarr und der Trubel der freien Marktwirtschaft, und um Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen, sind die Karten zu verkehrsstarken und verkehrsschwachen Reisezeiten unterschiedlich teuer. Das ist ärgerlich, aber verständlich, und sehr angelsächsisch. In Italien sind die Komplikationen anders gelagert. Wer hier den wirklichen Durchblick haben will, müsste über die gesamte italienische Regierungs- und Sozialpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg im Bilde sein.
Zuallererst gilt, dass Zugfahrkarten billig sein müssen, und zwar offensichtlich billig. Dahinter steckt das Bedürfnis der Menschen, in der einen Stadt zu leben und in einer anderen zu arbeiten, verbunden mit der Tatsache, dass die italienischen Löhne und Gehälter zu den niedrigsten in Europa gehören. Ein Student muss es sich leisten können, jedes oder zumindest jedes zweite Wochenende nach Hause zu fahren. Die Freunde aus der Grundschule bleiben Freunde fürs Leben. Ohne sie kann man nicht sein. Und wer soll die Wäsche waschen, wenn nicht die geliebte Mutter? In Italien gibt es kaum Waschsalons. Die Fahrt von Verona nach Mailand – 148 Kilometer, sagt mir meine Fahrkarte – kostet also nur 6,82 Euro, egal zu welcher Tageszeit, ob werktags oder am Wochenende. ∗Das ist billig.
Zugleich wird die Eisenbahn traditionell dazu benutzt, überschüssige Arbeitskraft aufzunehmen und die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. »Beamte in Massen!«, schrieb D.H. Lawrence 1920 über den Bahnhof von Messina auf Sizilien. »Man erkennt sie an den Mützen. Elegante, forsche, kleine Beamte mit Schuhen aus Wildleder oder Lackleder, mit goldbetressten Mützen, einige mit schmalen, langen Nasen mit noch mehr Gold an den Mützen spazieren durch die Himmelspforten hinein oder heraus, kommen und gehen durch die vielen Türen.«
Seit Trenitalia in den letzten zwanzig Jahren hunderttausend Stellen abgebaut hat, ist das Unternehmen nicht mehr ganz so überbesetzt, beschäftigt aber immer noch weit mehr Personal pro Reisekilometer als seine Pendants in Frankreich, Deutschland oder England. Zehntausend der neunundneunzigtausend Bahnbediensteten gelten als überflüssig. Und die Mitarbeiter tragen immer noch schicke Mützen mit Goldlitze und glänzende Knöpfe an den dunklen Uniformjacken.
Eines Abends, als ich aus Venedig zurückkam und in dem kleinen Bahnhof Verona Porta Vescovo aussteigen wollte, gingen die Türen nicht auf. Im Interregionale gibt es einen roten Griff, den man hochzieht, sobald der Zug zum Stehen gekommen ist. Dann sollten die Türen sich seitlich öffnen. Ein Reisender nach dem anderen ruckelte und zerrte. Flüche und Verwünschungen. Da sich auf beiden Seiten des Zuges ein Bahnsteig befand, wurde auf beiden Seiten gezerrt und geruckelt. Gerade als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, flog eine Tür auf und eine Handvoll Reisender stieg eilig aus.
Woraufhin wir, während wir uns noch zu unserem knappen Entkommen gratulierten, von einem Mann mit einer wunderbar spitzen Mütze, die weit größer, gebauschter und vor allem röter war, als nötig schien, angebrüllt wurden. Es handelte sich um die Mütze des capostazione , des Bahnhofsvorstehers. Jemand erklärte, warum wir erst ausgestiegen waren, als der Zug schon wieder angefahren war, was natürlich streng verboten ist. » Non esiste! «, protestierte der wichtige Mann. Es konnte unmöglich sein, dass die Türen nicht aufgingen. Wir mussten etwas falsch gemacht haben. Etliche Fahrgäste bestätigten die Geschichte. » Non esiste! «, beharrte er. Das kann nicht sein. Wenn man bei Trenitalia arbeitet, ist es vielleicht manchmal nötig, die Augen vor der Realität zu verschließen.
Zum Beispiel ist klar, dass bei niedrigen (weniger als die Hälfte der bei der Deutschen Bahn und weniger als ein Drittel der bei den britischen Eisenbahngesellschaften üblichen) Preisen und hohen Personalkosten der Bahnbetrieb eine kostspielige Angelegenheit ist. Wie soll ein Land mit einer laufenden Staatsverschuldung von über 100 Prozent des Bruttosozialprodukts mit so etwas fertig werden? Eine Antwort lautet: il supplemento.
Kostet die Fahrt nach Mailand mit dem Interregionale 6,82 Euro, dann kostet die Fahrt mit dem schnelleren Intercity 11,05 Euro, oder vielmehr das Basisticket von 6,82 Euro zuzüglich eines Zuschlags, des supplemento , von 4,23 Euro; der noch (etwas) schnellere Eurostar kostet weitere 50 Cent mehr. Früher machte der Zuschlag nur einen geringen Prozentsatz des Ticketpreises aus, aber da bei der Berechnung der landesweiten Inflationsrate die Basispreise für Bahnfahrten herangezogen werden, die Preise für Intercityfahrten jedoch nicht, jedenfalls bis vor Kurzem nicht, sind die Zuschläge im Verhältnis zum Basistarif tendenziell stärker gestiegen. Durch solche Tricks lässt sich ein Großteil der Inflation verstecken. Aber was bekommt man für dieses Extrageld? Der Interregionale braucht vierzehn Minuten länger als der Intercity und vierundzwanzig Minuten länger als der Eurostar. Sind vierzehn Minuten meiner Zeit mir 4,23 Euro wert?
Aber so einfach ist es nicht.
Um die Leute zum Kauf der teureren Tickets zu motivieren, verschwinden die Interregionali zu bestimmten Tageszeiten vom Fahrplan, besonders auf längeren Strecken. Auf der anderen Seite jedoch, und das läuft der Logik von Angebot und Nachfrage komplett zuwider, gibt es für die, die mit den lebenden Toten reisen, wie ich es oft gezwungen bin zu tun, nur Interregionali, um die ärmeren Pendler zu versorgen, die Verdammten, diejenigen, die sich nicht jeden Tag die höheren Fahrpreise leisten könnten; all das verdankt sich dem ziemlich frommen, aber immer begrüßenswerten italienischen Engagement für eine bestimmte Art des volksnahen Sozialismus (mit dem der Katholizismus und der Faschismus natürlich eng verwandt sind). Je größer also die Nachfrage, desto niedriger der Preis.
Wir haben also den Interregionale Mailand–Genua um 6.40 Uhr morgens und den fürchterlichen Interregionale Mailand– Venedig um 18.15 Uhr abends. Seltsamerweise sind diese hoffnungslos überfüllten Pendlerzüge, die zu niedrigen Preisen zu den Stoßzeiten verkehren, die verlässlichsten und pünktlichsten überhaupt. Da sie mit Lok und Waggons, die 180 Stundenkilometer fahren können, in zwei Stunden nur eine Strecke von 160 Kilometern bewältigen müssen, haben sie viel zeitlichen Spielraum.
Am ersten Tag jedes neuen akademischen Jahres kaufe ich mir also meine Dauerkarte nach Mailand. Dafür gibt es keinen Extraschalter. Man stellt sich mit allen anderen gemeinsam an. Vier Schalter sind besetzt, sechs unbesetzt. Zum Glück wurde vor Kurzem im Bahnhof Verona Porta Nuova das Einschlangensystem eingeführt – eine lange, gewundene Schlange zwischen Seilabsperrungen, um die Frustrationen zu vermeiden, zu denen es immer wieder kommt, wenn man den falschen Schalter wählt und stundenlang anstehen muss. Wir alle haben dieses Zeichen des Fortschritts und der Zivilisation sehr begrüßt. Die Seile sind in schickem Rot-Weiß gehalten und hängen zwischen glänzenden Chrompfosten; aber beim Aufbau der Absperrung wurde nicht darauf geachtet, denen, die sich nicht hinten angestellt haben, den Zugang zu den Schaltern zu verwehren, sodass man auch durch den vorgesehenen Ausgang eintreten kann.
Ein Mann lehnt Kaugummi kauend an einer Säule, beobachtet die Schalter, wartet und geht dann, genau als ein Schalter frei wird, mit schnellen Schritten darauf zu und drängelt sich vor. Die Kartenverkäuferin weiß, was passiert ist, protestiert aber nicht. Die Leute in der Schlange grummeln, greifen aber nicht ein. Das hat mich in Italien immer erstaunt, dieses allgemeine Schulterzucken angesichts eines furbo , eines Schlitzohrs. Es lohnt sich in diesem Land immer, es zu versuchen. Sollte es doch einmal unangenehm werden, kann man immer noch behaupten, man hätte nicht Bescheid gewusst.
Читать дальше