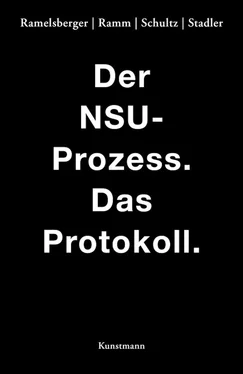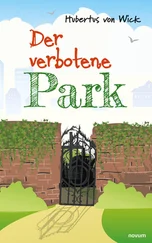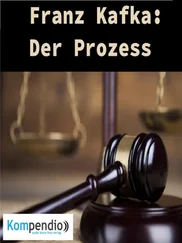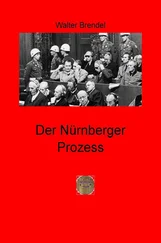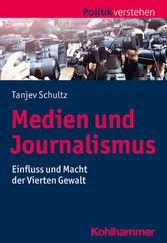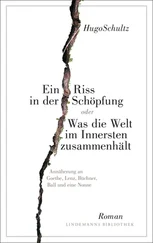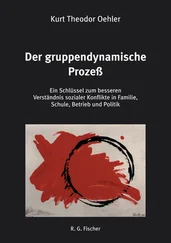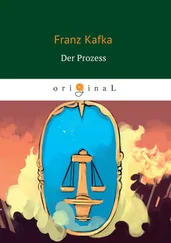Wer sich später exakt erinnern will, was im wichtigsten Prozess der vergangenen Jahrzehnte wirklich passiert ist, welcher Zeuge gelogen und wer die Wahrheit gesagt hat, der musste sich die Mühe machen, Tag für Tag persönlich im Gerichtssaal A 101 des Oberlandesgerichts an der Nymphenburger Straße in München zu erscheinen und per Hand oder auf dem Laptop mitzuschreiben. Doch schon der Zugang zum Gericht war beschränkt: Die 50 Plätze für Journalisten wurden unter vielen Interessenten verlost. Dem Magazin der Süddeutschen Zeitung ist es gelungen, einen Platz zu erhalten. Daraufhin haben die Autoren Annette Ramelsberger, Wiebke Ramm, Tanjev Schultz und Rainer Stadler die Protokolle Tag für Tag, Jahr für Jahr, mit dem Laptop auf den Knien tagsüber mitgeschrieben und anschließend an langen Abenden sortiert, geglättet und verdichtet. Das Team hat keinen einzigen der Prozesstage versäumt, vom Beginn am 6. Mai 2013 bis zum Ende am 11. Juli 2018. So sind die NSU-Protokolle entstanden – eine Sammlung von Original-Zitaten und Dialogen als Dokumentation eines in der deutschen Nachkriegsgeschichte einmaligen Prozesses.
Die Protokolle sind nicht durch die interessengeleitete Sichtweise von Anklägern, Verteidigern oder Nebenklägern bestimmt, sie zeigen – soweit das möglich ist – ein unparteiisches, authentisches, weitgehend unkommentiertes Gesamtbild des Prozesses, die Essenz von Hunderten Verhandlungstagen. Redundantes wurde weggelassen, juristische Feinheiten auf das zum Verständnis unbedingt Nötige reduziert, stundenlange Befragungen von wortkargen Zeugen, die alle im Gerichtssaal als quälend empfunden haben, sind auf zentrale Aussagen und Dialoge reduziert. Wegen der historischen Bedeutung des Prozesses war den Autoren von Anfang an bewusst, dass sich die Protokolle nicht nur ans Fachpublikum wenden, sondern auch interessierten Laien zugänglich sein sollten. Allein deshalb erwies sich eine gewisse Straffung der Mitschriften als unumgänglich. Gleichzeitig war es natürlich das Ziel, alle für das Verständnis und die Bewertung des Verfahrens relevanten Inhalte zu dokumentieren, So wurde ein Umfang von knapp 2000 Seiten erreicht. Mehr wären nicht mehr lesbar gewesen, weniger hätten zu viele Lücken gelassen.
Wegen der Persönlichkeitsrechte mussten manche Namen von Zeugen abgekürzt werden, ihre Aussagen, auch ihr Sprachduktus aber blieben unverändert. Aus den Protokollen ertönt ein Chor unterschiedlichster Stimmen: Der Brandsachverständige redet nicht von Ruß, sondern von »thermischer Beaufschlagung«. Die Polizistin sagt, das Opfer sei »ex« gewesen, wenn sie erklären will, dass der Mensch schon tot war, als sie kam. Neonazis sprechen von »national« oder »normal«, wenn sie rechtsradikal meinen. Alle diese Facetten bilden die Protokolle ab. Diese Protokolle sind im wahrsten Sinne Mit-Schriften. Das Gericht hat den Audio-Mitschnitt des Verfahrens verboten. Die Inhalte der Protokolle wurden nach journalistischen Kriterien ausgewählt, nicht nach juristischen. Deswegen ist nicht jeder einzelne Antrag, der für Juristen interessant sein könnte, mit aufgenommen, dafür aber finden sich darin Dialoge, die die Dynamik der Beziehungen unter den Prozessbeteiligten zeigen.
Besonders wichtig war dem Autorenteam, die lebhafte Auseinandersetzung in diesem Prozess zu zeigen: die Wortwechsel zwischen Richter und Verteidigung, die Originaltöne der Zeugen, die beklemmenden Auftritte der Eltern von Opfern und Tätern, kurz: die akribische Suche nach der Wahrheit. So ist dieses Werk entstanden, das gewährleisten will, was eigentlich Aufgabe des Rechtsstaats wäre: jeder interessierten Leserin, jedem interessierten Leser die Möglichkeit zu geben, die Geschehnisse dieses fünf Jahre dauernden Verfahrens nachzulesen und sich anhand dessen ein eigenes Urteil zu bilden.
Die Lehren aus dem Prozess
Der NSU-Prozess hat gezeigt, dass Hass und Gewalt nicht auf die Terrorzelle aus Zwickau beschränkt sind. Wer den NSU-Prozess verfolgt hat, der wundert sich nicht mehr darüber, wie viele »besorgte Bürger« während der Flüchtlingskrise in Clausnitz, Freital und Dresden aufmarschierten, randalierten, einen Bus mit Flüchtlingen umstellten und in Dresden bei der Einheitsfeier den Bundespräsidenten niedergrölten oder kleine Galgen für Kanzlerin Merkel herumtrugen. Der Hass, aus dem die NSU-Morde verübt wurden, ist eingedrungen in die Gesellschaft.
Als der NSU nach zehn Morden, drei Sprengstoffattentaten und 15 Raubüberfällen im November 2011 aufgeflogen war, beschwichtigten etliche Sicherheitsverantwortliche: So eine Terrorserie könne sich in Deutschland nicht wiederholen. Nach diesem Prozess ist klar: Dafür gibt es keine Garantie.
Längst sind neue rechtsradikale Täter aufgetreten. Egal, ob in Salzhemmendorf bei Hannover bis dahin unbescholtene Bürger eine Whatsapp-Gruppe namens »Garage Hakenkreuz« gründeten und dann Molotowcocktails in das Kinderzimmer einer Flüchtlingsfamilie warfen. Egal, ob in Freital in Sachsen sich Busfahrer und Handwerker zu einer Kampfgruppe gegen linke Politiker, Bürgerrechtlerinnen und Flüchtlinge zusammenrotteten – direkt gegenüber der Polizeiwache. Egal, ob Rechtsradikale in einer »Oldschool Society« genannten Terrortruppe Attentate planten. Überall sind ähnliche Denkmuster, Strukturen, Unterstützernetzwerke zu finden wie man sie beim NSU beobachten konnte.
Im NSU-Prozess war die Ursuppe all dieser Ressentiments, dieser Geheimbündelei, dieser sich gegenseitig aufhetzenden Rassisten zu finden – genauso wie die Prototypen der wegschauenden, versagenden Staatsvertreter. In den Protokollen kann nun jede und jeder nachlesen, wie der O-Ton Rechts sich anhört. Mit welchen Worten, welchen Argumenten sich Staatsschützer herauswinden und Terror-Helfer und -Unterstützerinnen abwiegeln. Auch diesen Blick auf die Realität will dieses Werk bieten.
Der Prozess hat gezeigt, dass es eben nicht gereicht hat, wegzusehen, damit rechte Umtriebe verschwinden. Sondern, dass Rechtsradikale durch Verharmlosung stark gemacht wurden und sich sogar stillschweigend unterstützt fühlten, weil ihnen niemand entschlossen entgegentrat. Aus dieser Erkenntnis kann die Gesellschaft Lehren ziehen – für die Gegenwart und für die Zukunft.
ANNETTE RAMELSBERGER
WIEBKE RAMM
TANJEV SCHULTZ
RAINER STADLER
DAS PROTOKOLL
BEWEISAUFNAHME
TAG 1–374
6. Mai 2013
Manfred Götzl, 59, Richter. Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl, Verteidiger von Beate Zschäpe.
(Alle Plätze im Saal A 101 des Oberlandesgerichts München sind belegt, die ersten Besucher standen um zwei Uhr morgens an. Beate Zschäpe wird um 9.56 Uhr in den Saal geführt. Sie steht zwischen ihren Anwälten und dreht den Kameras der Fotografen und Fernsehleute, die bis kurz vor Prozessbeginn Aufnahmen im Gerichtssaal machen dürfen, den Rücken zu. Die anderen Angeklagten sitzen in ihren Bänken, neben ihren Anwälten. Der Angeklagte Carsten Schultze, der im Zeugen schutzprogramm ist, versteckt sein Gesicht unter einem Kapuzenpulli. Nur Ralf Wohl leben und Beate Zschäpe sind in Haft, die anderen drei Angeklagten sind auf freiem Fuß. Kurz vor 10.30 Uhr treten die drei Richter ein, Manfred Götzl, Peter Lang, Konstantin Kuchenbauer, sowie die Richterinnen Michaela Odersky und Renate Fischer, begleitet von drei Ergänzungsrichtern, Gabriele Feistkorn, Peter Prechsl, Axel Kramer. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl ergreift das Wort.)
Götzl (zu den Angeklagten und deren Verteidigern) Guten Morgen! (zu den Vertretern der Bundesanwaltschaft) Guten Morgen! (zu den Nebenklägern) Guten Morgen! (zur Besuchertribüne) Guten Morgen! Bitte nehmen Sie Platz! Ich eröffne die Sitzung des 6. Strafsenats des Oberlandesgerichts München. Es kommt zum Aufruf das Verfahren gegen Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, André Eminger, Holger Gerlach und Carsten Schultze. Ich stelle zunächst die Präsenz fest: die Angeklagte Zschäpe mit ihren Verteidigern Herrn Heer, Herrn Stahl und Frau Sturm. Der Angeklagte Eminger mit seinen Verteidigern Herrn Kaiser und Herrn Hedrich, der Angeklagte Wohlleben mit seinen Verteidigern Frau Schneiders und Herrn Klemke, der Angeklagte Carsten Schultze mit seinen Verteidigern Herrn Hösl und Herrn Pausch, der Angeklagte Gerlach mit seinen Verteidigern Herrn Hachmeister und Herrn Rokni-Yazdi. Die Vertreter der Bundesanwaltschaft Herr Diemer, Frau Greger, Herr Weingarten, Herr Schmidt.
Читать дальше