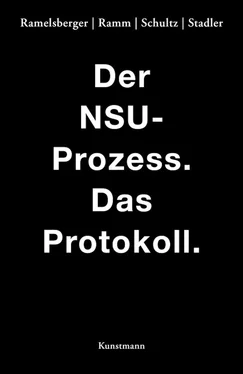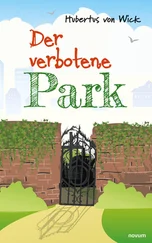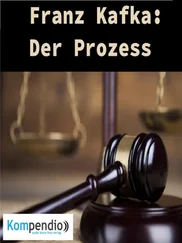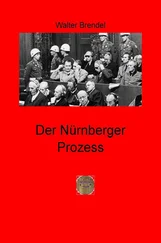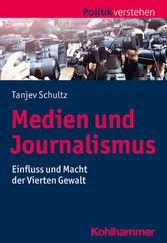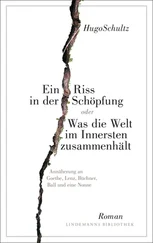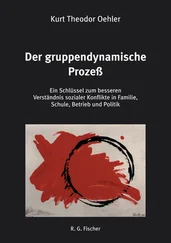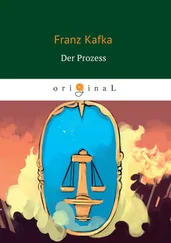Immer wieder wurde in diesem Prozess deutlich, wie sehr sich die Jahre voll ungerechtfertigter Verdächtigungen bei den Angehörigen der Opfer eingegraben haben: Die Ermittler hielten sie für verstockt, für eingesponnen in Mafia-Kreise, in den Drogenhandel. Ihre Nachbarn wurden befragt, ob sie von Liebschaften, Spiel- oder Sex-Sucht der Getöteten wüssten. Die Hinterbliebenen waren beschämt und trauten sich jahrelang nicht mehr auf die Straße. Der Witwe des ersten Mordopfers Enver Şimşek hatten Polizeibeamte ein Bild mit einer blonden Frau gezeigt und erklärt, das sei die heimliche Geliebte ihres Mannes. Er habe zwei Kinder mit ihr. Kein Wort war wahr. Die Witwe war schon dankbar, als ihr ein Polizist nach Monaten sagte, das sei nur eine Finte gewesen, man habe gehofft, so das »Schweigekartell« der Familie zu erschüttern. Auf die Familie Yozgat, deren Sohn in Kassel ermordet worden war, wurde ein verdeckter Ermittler angesetzt, die Anschlüsse von Eltern und Geschwistern wurden monatelang überwacht. Die Witwe eines Mordopfers in München sollte auf Drängen anderer Eltern ihre Tochter von der Schule nehmen. Die Eltern hatten Angst, der Täter aus »türkischem Milieu« könnte auch ihre Kinder treffen, wenn sie in der Pause auf dem Schulhof spielten.
Die Opferfamilien empfanden die Enttarnung des NSU geradezu als Befreiung von einem Alpdruck. Sie erschienen immer wieder im Prozess, um mehr zu erfahren. Sie erlebten, wie das Gericht herausdestillierte, dass die Mordwaffe, eine Česká 83, von einem Waffenhändler in der Schweiz über einen krebskranken Zwischenhändler und einen ostdeutschen Freund in die rechte Szene von Jena gelangte und schließlich dort im Szeneladen Madley an Carsten Schultze übergeben wurde. Und wie der sie dann nach Chemnitz zum NSU brachte. Die Angehörigen hörten im Gerichtssaal, welches Unterstützernetzwerk die drei Untergetauchten hatten. Sie erfuhren, wie rechte Kameraden und Kameradinnen den dreien Wohnungen und Pässe besorgten, für sie Apartments anmieteten, dass der Angeklagte André Eminger Beate Zschäpe sogar als seine Frau ausgab, als sie einmal nach einem Wasserschaden in der Wohnung als Zeugin bei der Polizei aussagen musste.
Viele Angehörige konnten nicht fassen, wie nah Polizei und Verfassungsschutz den drei Untergetauchten immer wieder gewesen waren. Einmal, nach dem Wasserschaden, war Beate Zschäpe sogar im Polizeirevier Zwickau gesessen. Kühn hatte sie behauptet, sie habe in der Wohnung nur die Blumen gegossen. Der Polizist glaubte ihr.
Angeblich wusste keiner, wo sich die drei aufhielten. Dabei war der NSU geradezu umstellt von Spitzeln. Tino Brandt, bestbezahlter V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes, telefonierte sogar mit den untergetauchten Neonazis. Er berichtete darüber dem Verfassungsschutz. Aber Konsequenzen folgten nicht. Auch andere Dienste hatten Spitzel in der Szene, die davon berichteten, die drei wollten nach Südafrika gehen. Auf die Spur aber kamen ihnen die Dienste nicht. Wichtige Informationen wurden nicht beachtet, nicht weitergegeben oder falsch bewertet, V-Leute wurden vor Polizeiaktionen gewarnt. Nicht nur den Angehörigen der Opfer drängte sich angesichts der vom Gericht befragten Verfassungsschutzmitarbeiter und deren V-Männer der Eindruck auf, dass Polizei und Verfassungsschutz fatale Fehler gemacht hatten – auf allen Ebenen und immer wieder.
Obwohl diese Versäumnisse im Prozess offen zu Tage traten, die Fehler der Ermittler vom Gericht ausführlich mitprotokolliert wurden und den Angehörigen der Opfer viel Zeit eingeräumt wurde, um den Schmerz über den Verlust der Ermordeten zu schildern, hinterließ der Prozess bei vielen Nebenklägern einen bitteren Nachgeschmack. Sie hatten dieses Mammutverfahren über all die Jahre verfolgt, waren immer wieder von weit her angereist, hatten Zeit und Kraft geopfert, um dabei zu sein. Sie hatten sich erhofft, dass das Gericht am Ende das Unrecht, das ihnen angetan worden ist, die Unzulänglichkeiten der Behörden und die vielen offenen Fragen im Zusammenhang mit den NSU-Morden zumindest erwähnt. Sie wurden enttäuscht. Richter Manfred Götzl beschränkte sich in seinem nur vier Stunden umfassenden mündlichen Vortrag auf eine knappe, fast kursorische Beweiswürdigung. Kein Wort an die Angehörigen, kein Satz über das Versagen des Staates, nichts zur gesellschaftlichen Bedeutung dieses Verfahrens.
Ein Nebenklage-Anwalt hatte noch wenige Monate vor dem Urteil das Gericht gemahnt: »Ich bin überzeugt davon, dass dieser Senat ein Urteil fällen wird, das der Revision standhält. Ich darf an Sie appellieren: Sprechen Sie ein Urteil, das auch vor der Geschichte Bestand hat.« Er hatte damit vielen Opferfamilien aus der Seele gesprochen. Nach der Urteilsverkündung verließen viele Angehörige das Gerichtsgebäude fassungslos.
Aus dem Versagen staatlicher Behörden ist geradezu ein Wald an Verschwörungstheorien gewachsen. Mit jedem neuen Kriminalroman, mit jedem neuen Film, der sich an den NSU-Komplex anlehnt, wächst dieser Wald weiter. Da taucht in vorgeblich authentischen Fernsehfilmen ein V-Mann auf, der berichten kann, wie alles im Innersten zusammenhing – und kurz, bevor er sein Wissen der Polizei preisgeben will, als er mit dem Auto schon auf dem Weg zum Revier ist, jagt jemand den Wagen in die Luft. So einen Vorfall hat es nie gegeben, dennoch ist er bis heute Gegenstand wilder Spekulationen, und das nicht nur auf einschlägigen Internetseiten. In den Geschichten über den NSU wimmelt es von Dunkelmännern, die an Beate Zschäpe nur wie an der Marionette einer Staatsverschwörung ziehen. Gerade Rechtsextremisten versuchen, die gesamte Schuld auf die Behörden abzuwälzen und den NSU als bloße Erfindung des Staates darzustellen. Und ständig wird vom unheimlichen Zeugensterben im Fall NSU geraunt. Dabei haben nachträgliche Ermittlungen sehr viele dieser Verschwörungstheorien widerlegt.
Exemplarisch dafür steht der Fall Florian H. Der 21-Jährige verbrannte 2013 in seinem Auto in Stuttgart. Er wollte schon vor dem Auffliegen des NSU etwas über eine Neonazi-Organisation mit dem Namen NSU gehört haben. Er wurde vernommen, es wurde ermittelt, danach glaubte man ihm nicht mehr: Er nannte den NSU eine der größten Neonazi-Vereinigungen in Deutschland und konnte auch den Ort in seiner kleinen Gemeinde nicht mehr wiederfinden, wo er den NSU angeblich getroffen hatte. Dennoch sollte der Zeuge erneut vernommen werden, doch am Morgen der Vernehmung verbrannte er in seinem Auto. Die Polizei geht von Selbstmord aus. Am Tatort gab es Zeugen, die niemanden sahen außer Florian H. Der hatte sich kurz zuvor an der Tankstelle Benzin gekauft, das er dann entzündete. Der NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg hat sich intensiv mit dem Fall beschäftigt und kam zu dem Ergebnis, dass es keine Anhaltspunkte für einen Mord gibt. Dennoch lebt diese Theorie hartnäckig weiter.
Die Ignoranz, die Schlamperei und die Abschottung der Geheimdienste haben den Argwohn wachsen lassen. Manche Bürger trauen den Sicherheitsbehörden mittlerweile alles zu. Sie haben den Eindruck gewonnen, staatliche Stellen hätten den Terror bewusst und vorsätzlich gedeckt oder sogar gefördert. Solide Belege dafür fehlen. Gut belegt ist aber, dass sich der Staat mit dubiosen Spitzeln aus der rechtsextremen Szene eingelassen hat, die er oft nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und dass er bei der Besetzung von Führungspositionen in den Sicherheitsbehörden geradezu fahrlässig vorging. So galt der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes Helmut Roewer im Kreis seiner Kollegen im Bund und in den Ländern schon lange als Skandalfigur. Als der NSU aufflog, war er schon im Ruhestand, die Versäumnisse seines Amtes in Sachen NSU fielen in seine Zeit.
Der Versuch, die Untergetauchten zu finden, indem man die rechte Szene mit Spitzeln durchdringt, ist im NSU-Fall gescheitert. Rund um den NSU hatte der Verfassungsschutz etliche V-Leute platziert, die angeblich alle nicht genau gewusst haben wollen, wo sich das untergetauchte Trio aufhielt und was es tat. Einige V-Männer, wie Tino Brandt, waren den Gesuchten dicht auf der Spur, zugleich beteiligten sie sich an Hilfsaktionen für das Trio und spendeten sogar Geld – Geld des Steuerzahlers.
Читать дальше