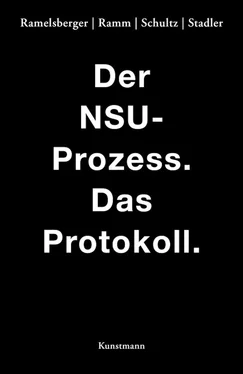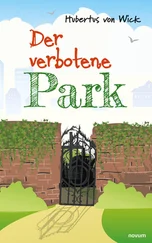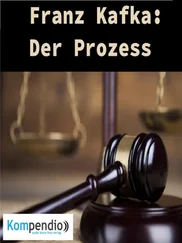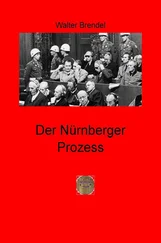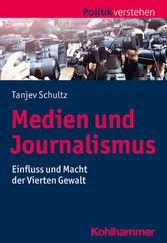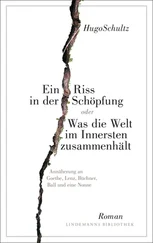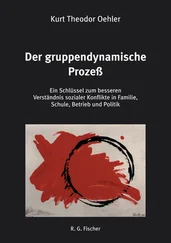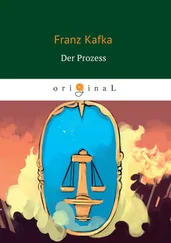Selten hat ein Verbrechen das Land so aufgewühlt wie die Mordserie des NSU. Denn der NSU stellte auch alle Gewissheiten der Sicherheitsbehörden infrage. Die hatten jahrelang die Überzeugung zur Schau gestellt, dass es in Deutschland keinen Terror von rechts gibt. Die Taten, so erklärten sie wiederholt, mussten auf die türkische Mafia zurückgehen oder auf Revierkämpfe im Rauschgiftmilieu. Die Medien nannten die Morde an den neun Migranten auch abfällig »Dönermorde« – allein dieses Wort zeigte schon, wer im Verdacht stand. Die immer drängenderen Fragen der Angehörigen, ihre Hinweise, dass es sich bei dem Serienmörder um einen »Türkenhasser« handeln musste, wurden nicht ernst genommen.
Der Verfassungsschutz hatte Fragen nach der Existenz einer braunen RAF (der linksextremen Rote Armee Fraktion, die in den 70er, 80er und 90er Jahren mordete) stets abgetan: Zu dumm seien die Rechten, zu sehr seien sie von Staatsspitzeln umstellt, als dass sich Terrorzellen unbemerkt entwickeln könnten. Zu sehr fehle es ihnen auch an einer intelligenten Führungsfigur. Dabei brauchten die Radikalen gar keinen Führer mehr. In der rechten Szene kursierte längst das Buch »Die Turner Tagebücher« des amerikanischen Rechtsradikalen William L. Pierce, wonach es zu einem Kampf der Rassen gegeneinander kommen werde und die Weißen Terrorzellen bilden müssten, um »leaderless resistance« (führerlosen Widerstand) zu leisten – aber das hatten die Verfassungsschützer nicht ernst genommen. Auch auf den Computern etlicher Angeklagter im NSU-Prozess wurden die »Turner Tagebücher« gefunden.
Auf die Selbstenttarnung des NSU folgte in den Monaten darauf der Rücktritt des Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes und der Präsidenten der Landesverfassungsschutzämter von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin. Fast ein Dutzend Untersuchungsausschüsse machten sich an die Arbeit, Behördenleiter wurden vernommen, Verantwortlichkeiten hinterfragt, Beamte ins Kreuzverhör genommen. Entdeckt wurden: lähmende Bürokratie, Dienst nach Vorschrift, ein Gegeneinander in den Ämtern, Abschottung der Dienste, gravierende Fehleinschätzungen. Und der nach Aufklärung drängende Verdacht, dass bei manchem Verfassungsschützer auch das rechte Auge zugedrückt wurde. So erklärte zum Beispiel ein Verfassungsschützer aus Thüringen noch vor Gericht, er habe seinen Spitzel »gut im Griff« gehabt – er meinte jenen V-Mann, der einen Großteil seines Honorars von rund 200 000 Mark an seine Neonazi-Freunde weitergeleitet hatte. Und ein Beamter des Bundesverfassungsschutzes schredderte noch nach der Enttarnung des NSU geheime Akten zur rechten Szene in Thüringen. Er wusste, wie viele V-Leute sein Dienst dort hatte und wollte, so sagte er, unbequeme Nachfragen dazu verhindern, warum die Geheimdienste dennoch nichts über den NSU wussten. Der Mann wurde in eine andere Behörde versetzt, ein Verfahren gegen ihn nach einer Geldzahlung eingestellt.
Am Ende des zweiten Untersuchungsausschusses des Bundestags im Sommer 2017 waren sich viele Prozessbeobachter sicher: Polizei und Verfassungsschutz hätten die Morde verhindern können, wenn sie die Hinweise ihrer V-Leute ernst genommen und schnell eingegriffen hätten.
Viele Stunden parlamentarischer Kontrollarbeit, Tausende Seiten Papier. Aber nirgendwo gelang die Tiefenbohrung in die deutsche Gesellschaft so präzise wie im Gerichtssaal A 101 des Oberlandesgerichts München. Nirgendwo kam man den Tätern, ihren Helfern, ihren Sympathisanten und ihren Motiven so nah wie hier.
Auf der Anklagebank saßen eine Frau und vier Männer: Beate Zschäpe (geboren 1975), Ralf Wohlleben (1975), Carsten Schultze (1980), Holger Gerlach (1974) und André Eminger (1979). Die Bundesanwaltschaft warf den Männern vor, Waffen, Wohnungen, Geld oder Ausweise für die Terrorzelle besorgt zu haben. Die Anklage gegen Beate Zschäpe lautete, sie sei gleichberechtigtes Mitglied des NSU gewesen, und habe – obwohl sie wohl an keinem Tatort war – die Morde ihrer Gefährten Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erst möglich gemacht. Als sie am 4. November 2011 erfuhr, dass sich ihre Freunde nach einem Banküberfall in ihrem Wohnmobil erschossen hatten, verschickte sie das Bekennervideo für die Morde. Sie zündete den gemeinsamen Unterschlupf in Zwickau an und stellte sich nach einer tagelangen Odyssee durch die Republik in ihrer Heimatstadt Jena der Polizei. Seitdem saß sie in Haft.
Die Angeklagten zeigten geradezu exemplarisch die verschiedenen Spielarten des deutschen Rechtsradikalismus: Ralf Wohlleben, der politische Funktionär, der eine Karriere in der NPD anstrebte und sich als treusorgender Familienvater und friedliebender Patriot gab, der nur Angst vor Überfremdung habe; Holger Gerlach, der fleißige, aber spielsüchtige, etwas naive Lagerarbeiter, der wie ein Handlanger seinen Freunden bis zuletzt Pässe und Führerscheine zur Verfügung stellte, aber vorgab, nichts von deren Morden gewusst zu haben. André Eminger, der überzeugte Neonazi, der seinen Körper über und über mit Hass-Parolen tätowiert hat, Weihnachtskarten mit germanischen Runen verschickte und im Prozess kein Wort sagte – selbst als er im September 2017 im Gerichtssaal überraschend in Haft genommen wurde. Und Carsten Schultze, der als junger Mann von der rechten Gemeinschaft und dem Männlichkeitskult angezogen war und dann merkte, dass Homosexuelle wie er dort abgelehnt wurden. Schultze stieg schon im Herbst 2000 aus der Szene aus. Zuvor hatte er dem NSU noch die Tatwaffe für neun Morde überbracht. Seine Tat holte ihn elf Jahre später wieder ein.
Im Mittelpunkt des Prozesses aber stand die Hauptangeklagte. Je nach Sichtweise ist Beate Zschäpe die rechtsextreme Terroristin. Oder die Stellvertreterin, die nur für ihre toten Neonazi-Freunde vor Gericht stand. Oder das verführte, abhängige Mädchen. Oder gar die Marionette der Geheimdienste, so eine beliebte Deutung rechtsextremer Kreise. Es gab viele Prozessbeteiligte, die sagten, es sei doch klar, dass Zschäpe nicht die Geisel des NSU war, sondern eher die Kraft, die alles zusammenhielt. Dass ein heimliches Leben, bei dem man so aufeinander angewiesen ist wie Zschäpe und ihre Männer, nur aufrechtzuerhalten ist, wenn ein gemeinsames Ziel die drei zusammenschweißte. Geselliges Prosecco-Trinken mit den Nachbarn oder Radfahren im Urlaub, so wie Zschäpe das erzählte, konnte es kaum gewesen sein, so sah es auch der psychiatrische Gutachter Henning Saß, der Zschäpe vier Jahre lang beobachtet und ihr Verhalten analysiert hat. Er hielt sie für eine selbstbewusste, eigenständige Frau, die andere manipulieren konnte. Saß sah sie als voll schuldfähig an und sagte, sie sei auch noch immer gefährlich.
Der von der Verteidigung Zschäpes aufgebotene psychiatrische Gutachter Joachim Bauer dagegen diagnostizierte bei ihr eine Persönlichkeitsstörung, die sie krankhaft abhängig von ihren Gefährten gemacht habe und deswegen auch unfähig, sich von ihnen zu lösen, obwohl sie immer wieder von ihrem Freund Uwe Böhnhardt geschlagen worden sei. Psychiater Bauer sah Zschäpe als vermindert schuldfähig an und erklärte sogar, sie habe 13 Jahre lang in »verschärfter Geiselhaft« bei ihren Freunden gelebt. In einer E-Mail an eine Zeitung verglich er das Verfahren und dessen mediale Begleitung mit einer Hexenverbrennung und erklärte, man wolle in Zschäpe »das nackte Böse in einem weiblichen Körper« sehen. Die Nebenkläger beantragten, den Psychiater für befangen zu erklären. Das Gericht erklärte ihn tatsächlich für befangen – es war der einzige Befangenheitsantrag im gesamten Prozess, der Erfolg hatte.
Die Anklage sah die Rolle von Zschäpe völlig anders. Die 1975 geborene Frau aus Jena war für die Bundesanwaltschaft ein unverzichtbarer Teil der Terrorzelle – weil sie die Tarnung für die Männer lieferte. Weil bei ihr der sichere Rückzugsort war, an den Mundlos und Böhnhardt nach den Morden zurückkehren konnten. Für den Generalbundesanwalt galt: Die Frau war nicht nur Helferin, sie war gleichberechtigte Mittäterin ihrer Männer, selbst wenn sie nicht selbst getötet hatte und an keinem Tatort beobachtet worden war. Das ist nichts wirklich Neues: Bereits in etlichen Prozessen gegen die RAF hatten Gerichte Angehörige der Terrororganisation wegen der Mittäterschaft bei Anschlägen verurteilt, obwohl sie nicht selbst geschossen hatten. Sie galten als Mittäter, weil sie einem Kommando angehört und den Anschlag gewollt hatten. Um als Mörder verurteilt zu werden, muss man nicht selbst den Finger am Abzug gehabt haben – das hat die Rechtsprechung gegen die Kommandos der Rote Armee Fraktion gezeigt.
Читать дальше