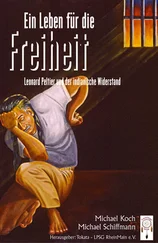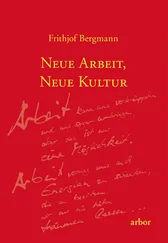1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Eine weitere Parallele zur extremen Auffassung des Untergrundmenschen von der Freiheit findet sich in einer Szene des Films über das Leben von T. E. Lawrence (Lawrence von Arabien)6 Sie kommt im letzten Drittel des Films vor, als Lawrence bereits eine kleine, aber schlagkräftige arabische Armee kommandiert, die schon eine lange Reihe glänzender Waffentaten vorzuweisen hat. Nach einem momentanen Rückschlag ist Lawrence dabei, eine größere, gut geplante Unternehmung vorzubereiten, die einen Sieg über die Türken und seinen Männern Ruhm und Beute verspricht. Er braucht jedoch mehr Truppen, und die Szene schildert seine Unterredung mit einem stolzen Stammesführer. In ihrem Verlauf trägt Lawrence dem Häuptling ein Argument nach dem anderen vor: „Dein Ruhm wird sich überall verbreiten, wenn du dich mir anschließt. Wir werden viel Geld machen. Das ist die Chance, mit den Türken abzurechnen, auf die du so lange gewartet hast. Zusammen werden wir dein Volk aus der Knechtschaft herausführen. Wir werden sie aus ihrem Untertanendasein befreien. Du kannst der Gründervater einer neuen, stolzen Nation sein.“ Unnahbar und ungerührt bleibt der Araber sitzen. Verächtlich schüttelt er bei jedem dieser Gründe den Kopf. Aber er weiß sehr gut, wie stichhaltig sie sind, und er spürt es. Seine Geste ist eine Weigerung, eine Abwehr; im Grunde zeigt sie seine Entschlossenheit, sich ihrem Gewicht nicht zu beugen. Schließlich ist Lawrence’ Arsenal erschöpft. Er hat jeden Grund angeführt, und jeder ist mit demselben Kopfschütteln beantwortet worden. Nun schweigen beide Männer, bis Lawrence kurz davor ist, sich zu erheben und knapp zu verabschieden. Da endlich spricht der Häuptling: „Ich schließe mich dir an“, sagt er, „aber nicht wegen des Ruhms, nicht wegen des Geldes; nicht einmal wegen meines Volkes. Nicht aus irgendeinem der Gründe, die du aufgezählt hast. Ich tue es, aber nur, weil es mir gerade in den Sinn kommt.“ Dieser Mann handelt im Grunde nicht gegen, sondern gemäß der Vernunft. Und doch will er das bemänteln, es als puren Zufall hinstellen. Wenn sein Handeln Resultat vernünftiger Überlegung wäre, wäre es wertlos. Dann wäre er nur ein Diener, der tut, was er tun muss. Also besteht er darauf, dass es willkürlich ist, eine bloße Laune. So versucht er, sein Handeln von allen äußeren Faktoren zu isolieren, ihm Autonomie zu geben und den Anschein, als rühre es nirgendwo her. Er gibt es frei und macht es sich dadurch zu Eigen.
Die Auffassung von Freiheit, die wir gerade untersucht haben, ist offensichtlich eine „späte“. Tief in der Subjektivität verankert, ist ihre düstere Pracht und verzweifelte Extravaganz die letzte Variation eines Themas, die in brillantem Eigensinn noch einmal einen ansonsten abgeflauten Impuls rekapituliert. Wir wenden uns nun dem gegenüberliegenden Punkt dieses Horizontes zu und blicken auf den Anfang, auf eine sehr frühe, recht primitive und deshalb umso aussagekräftigere philosophische Darstellung des Themas Freiheit.
Erste Philosophen der Freiheit: Sokrates und Platon
Sokrates’
Paradoxon …
Es war das verwirrendste, das sokratischste aller Paradoxa des Sokrates, das die Bühne für Platons Auseinandersetzung mit dem Problem des „freien“ Handelns abgab. Mit funkelnder Ironie hatte Sokrates seinen vielleicht aufrüttelndsten Lehrsatz in die Form einer scheinbaren Plattitüde gekleidet: „Niemand irrt sich absichtlich.“ Was könnte unschuldiger und unbestreitbarer sein? Wer könnte dagegen auch nur das Geringste sagen? Und doch, aus anderem Blickwinkel betrachtet, artikuliert diese scheinbare Tautologie die Essenz einer Ansicht über das Verhältnis des Menschen zum Bösen, die alles andere als gefällig ist. Ihre Konsequenzen machen das schnell klar. Wenn sich niemand „absichtlich irrt“, dann ist alles Böse (alles falsche Handeln) Resultat eines Irrtums oder höherer Gewalt. Damit stellt sie eigentlich also die radikale Behauptung auf, dass der „natürliche“ Impuls jedes Menschen immer auf das Gute gerichtet ist – denn nur das würde garantieren, dass der Mensch allein dann böse handelt, wenn er getäuscht oder gezwungen wird.
Sokrates’ trügerisch harmlose Formel erteilt in Wahrheit eine universale Absolution: Niemand ist im Grunde schuldig. Alle sind Opfer von Unwissenheit oder Zwang. Wie wenig tautologisch dieses Diktum in Wirklichkeit ist, wird noch offensichtlicher, wenn wir es mit christlichen Ideen vergleichen wie etwa Calvins „Auserwählten“ oder Luthers „Nicht durch die Werke, sondern allein durch den Glauben“, die die völlig konträre Annahme verkörpern, dass die „natürlichen“ Impulse und auch Handlungen des Menschen zu nichts führen.
Das tiefe Wohlwollen und die „Nächstenliebe“ seiner Position war für Sokrates wahrscheinlich nicht wichtiger als die subtil mit inbegriffene Konsequenz, dass Wissen – und vor allem das Wissen, das er vermittelte, die Kenntnis des Guten – von herausragender Wichtigkeit ist: Denn wenn der Mensch dieses Wissen einmal besitzt, wird – falls nicht Zwang herrscht – unvermeidlich das Gute getan werden. Dies muss Sokrates’ Sinn für Ironie sehr angesprochen haben.
… und seine Weiterentwicklung durch Platon
Dass diese idyllische Vision, in der Freiheit und Wissen zusammen genügen, um den Menschen gut zu machen, die Geburt eben von Freiheit und Wissen begleitete, hatte weitreichende Konsequenzen für deren spätere Geschichte. Unser Anliegen ist jedoch die Wichtigkeit, die Sokrates’ Paradoxon für Platon hatte.
Wir wissen, dass Platon sein philosophisches Projekt in einer Zeit grundlegenden Wertewandels unternahm. Das Ethos, das für uns beispielhaft in Homers Epen verkörpert ist, ein Gefüge von Tugenden, die einem kriegerischen, feudalen Volk angemessen sind, das noch nicht langfristig sesshaft geworden ist, passte für den Stadtstaat Athen nicht mehr. Seine Plausibilität war verblasst, neue Notwendigkeiten wurden spürbar. Tüchtigkeit, unbestreitbarer Erfolg, wie auch immer er erreicht wurde, war für das Überleben der früheren agrarischen Gesellschaft unverzichtbar gewesen, die für Bedrohungen von außen anfälliger gewesen war, und deshalb waren diese Qualitäten zu Tugenden erhoben worden. Innerhalb des alten Ethos hatte das Ansehen unter den Gleichrangigen, überhaupt die eigene Reputation, viel gegolten: Sie repräsentierte die Dankbarkeit der Gesellschaft gegenüber jenen, die zu ihrem Nutzen Hervorragendes leisteten; sie inspirierte zu glänzenden und mutigen Heldentaten. Aber jetzt, in der Polis, wurden andere Tugenden nötig. Ordnung, Verlässlichkeit und innerer Zusammenhalt mussten gestärkt werden, und das Augenmerk richtete sich auf „stille Tugenden“, vor allem die Gerechtigkeit.
Von den „äußeren“ zu den „inneren“ Tugenden
Zwei Faktoren, die diesen Wandel begleiteten, erfordern besondere Aufmerksamkeit. Da ist zum einen die Tatsache, dass die älteren Werte von kriegerischer Tüchtigkeit und sichtbarem Erfolg ihren Lohn ganz offensichtlich in sich tragen. Das tun sie auch für uns noch, wenn auch vielleicht nicht so extrem wie für die Griechen. Das Streben nach den Zielen, die von diesen Tugenden hochgehalten werden, ist in der Tat so „natürlich“, dass keine weitere Rechtfertigung nötig scheint, vor allem dann nicht, wenn hinter ihnen alte und farbenprächtige Traditionen stehen. Im Hinblick auf diese Werte könnte man wirklich sagen, dass „niemand sich absichtlich irrt“. Niemand würde mit Absicht Schwäche, Inkompetenz oder den Niedergang anstreben oder dem Erfolg willentlich das Scheitern vorziehen – das könnte man tatsächlich als unschuldige Tautologie stehen lassen. In Bezug auf die neueren Werte der Polis ist es aber zumindest nicht selbstverständlich, dass ordentliches Benehmen, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit „von Natur aus“ befriedigend sind, vor allem nicht, wenn sie Opfer verlangen. Es leuchtet überhaupt nicht ein, dass man diese neuen Werte nicht absichtlich vernachlässigen könnte. Diese Werte verlangen deshalb eine Rechtfertigung in einer Art und Weise, wie sie die früheren nicht brauchten.
Читать дальше