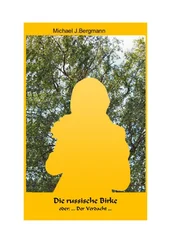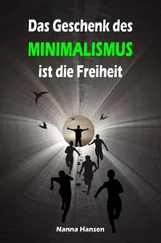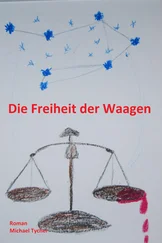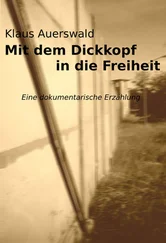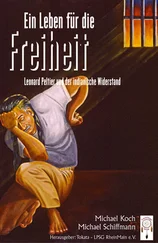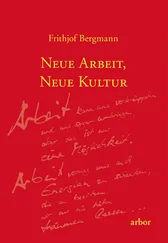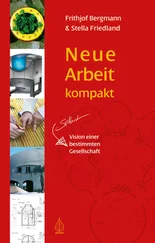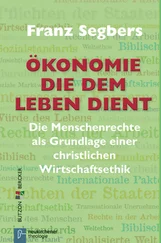Ein entfremdetes Selbst
Die Beklemmung und die rastlose Suche nach einer unerreichbaren Entschlossenheit, die diese Erfahrung begleiten, werden plausibel, wenn wir die Art und Weise betrachten, in der das Selbst sich unvermeidlich konzeptualisiert, wenn es ins Spiel kommt. Wenn die Erfahrung intensiv ist, fühlen wir uns von allem, was wir sind, abgeschnitten. Nicht nur unsere Vergangenheit, sondern sogar unsere momentanen Gedanken und Gefühle scheinen irgendwie weit weg zu sein, fremd, wie etwas, was wir beobachten. Wenn aber so viel „abgespalten“ und zum „Objekt“ gemacht worden ist, dann bleibt für das beobachtende Selbst nicht mehr viel übrig. Wenn das Selbst sich von den Elementen abtrennt, die es konstituieren, dann reduziert es sich auf etwas Substanzloses, auf nicht mehr als einen Punkt – den Punkt, von dem aus der Rest gesehen wird. Die Basis, von der aus ich dann wahrnehme, der Bereich, von dem ich das Gefühl habe, das „bin wirklich ich“, ist dann fast auf null geschrumpft, und dementsprechend wird deshalb das Gefühl der Isolation und des Mangels absolut.
Verzweifelte Suche nach Freiheit: Dostojewskijs „Mann aus dem Untergrund“
Grenzfall einer extremen Form von Freiheit
Als ein erstes Beispiel werden wir diesen Gefühlen eine ungezügelte und drastische Version der Freiheit gegenüberstellen. Es ist gerade das Extreme an ihr, was sie theoretisch lehrreich macht. Man könnte sie mit einem mathematischen oder juristischen Grenzfall vergleichen. Das Grundmaterial dieser prinzipiellen Sichtweise findet sich vielerorts, aber in besonders schlagender Form wieder bei Dostojewskij, diesmal in den Aufzeichnungen aus dem Untergrund4.
In der ersten Hälfte dieses Werkes, in der der in einer erbärmlichen Kellerwohnung hausende, verspottete, ständig auf und ab gehende kleine Regierungsbeamte seine Philosophie der Bosheit zu Papier bringt, gibt es eine Passage, in der Dostojewskij diesen Teil des Romans zu einem konzentrierten, kraftvollen Höhepunkt führt. Sein kleiner Beamter erklärt, dass nur ein Akt schierer Willkür, ausgeführt in völliger Unabhängigkeit, unter Missachtung jeglicher Vernunft und Vorteilhaftigkeit, eine wahrhaft metaphysische Dimension hat. Er proklamiert es als das summum bonum.5 Nichts anderes gibt dem Menschen wahre Freiheit. Nur solch ein Akt durchbricht den neutralen Panzer der Anonymität, der den Menschen gefangen hält. Allein auf diese Weise kann der Mensch einzigartig werden und sich dauerhaft von anderen abheben. Andernfalls hat das Selbst nicht mehr Identität oder Kontur als ein Ei unter einem Dutzend anderer.
Dieser kleine Beamte hat einen Freund, von dem er sagt: „Schickt sich dieser Herr zu einer Tat an, wird er ihnen sogleich wortreich und eindeutig darlegen, wie er nach den Gesetzen der Vernunft und der Wahrheit vorzugehen habe. Mehr noch: er wird Ihnen eine erregte und leidenschaftliche Rede über die wahren, normalen Interessen des Menschen halten, wird stotternd über die kurzsichtigen Dummköpfe herziehen, die weder ihre Vorteile noch den wahren Wert der Tugend zu erkennen vermögen, und – er kann eine Viertelstunde darauf ohne jede plötzliche äußere Ursache, vielmehr aus innerem Antrieb, der stärker ist als alle vorgetragenen Interessen, ganz anders handeln, das heißt deutlich wider seine eigenen Worte, wider die Gesetze der Vernunft, wider den eigenen Vorteil, kurz, gegen jede bessere Einsicht.“
In einem Ausbruch der Verzweiflung attackiert Dostojewskijs kleiner Beamter all die „Statistiker, klugen Forscher und Freunde der Menschheit“, all die klugen und berechnenden Systematiker, und schleudert ihren Bemühungen seine einzige, seiner Meinung nach jedoch vernichtende Erwiderung entgegen. All ihre auf Vernunft gegründeten, sorgsam konstruierten Gebäude müssen einstürzen, so behauptet er, denn in ihrer Aufzählung der Ziele und Zwecke, die der Mensch verfolgt, fehlt ein Ziel und Desideratum zwangsläufig. Und ironischerweise ist es das Wichtigste; es ist der „über alles vorteilhafte Vorteil“. Dieses Gut, das „wichtiger und vorteilhafter ist als alle anderen, besteht genau darin, „gegen alle Gesetze zu handeln; das heißt, gegen Vernunft, Ehre, Ruhe und Wohlstand – mit einem Wort gegen alle herrlichen und nützlichen Dinge“, es ist der „eigene ungezwungene freie Wille, die eigene, womöglich ungezügelte Laune, die eigene mitunter bis zum Irrsinn aufgestachelte Phantasie … Woher nehmen all die klugen Denker ihre Weisheit, dass der Mensch ein ‚normales‘, tugendhaftes Wollen nötig habe? Wieso bilden sie sich unerschütterlich ein, er brauche unbedingt einen vernünftigen, vorteilbringenden Willen? Was der Mensch braucht, ist allein das selbständige Wollen, was diese Selbständigkeit auch kostet und wohin sie auch immer führt.“
Freiheit als völlige Unabhängigkeit …
Dass eine repräsentative Formulierung dieser Idee von Freiheit nicht in einem klassischen philosophischen Text vorkommt, sondern stattdessen bei einem Romancier wie Dostojewskij gesucht werden muss, sollte uns nicht überraschen. Sogar diejenigen Philosophen, die den Fähigkeiten der Vernunft Grenzen setzen, neigen nicht dazu, Freiheit nur mit solchen Handlungen zu identifizieren, die gegen sie verstoßen. In literarischen Werken jedoch finden sich Varianten dieser Idee ziemlich oft (etwa bei William Blake; oder in André Gides „acte gratuit“, „zweckfreier Handlung“; oder bei D. H. Lawrence). Außerdem, wenn es so etwas wie eine grundlegende erfahrungsmäßige Bedeutung der Idee der Freiheit gibt, dann ist sie von den Ansichten des Mannes im Kellerloch nicht weit entfernt – und eher als eine vorsichtige philosophische Definition neigt natürlich die Literatur dazu, solche archaischen Regungen festzuhalten. Die Idee, völlig ungebunden zu sein, sich keiner wie auch immer gearteten Autorität zu unterwerfen (nicht einmal der der Vernunft), ganz unbeschwert zu handeln – diese Vorstellung scheint der Grunderfahrung der Freiheit ziemlich nahe zu kommen und beinhaltet etwas von ihrer ursprünglichen Anziehungskraft. Und da in allem Reden über Befreiung noch die Erinnerung an diese Erwartung durchscheint, haben wir damit begonnen.
Die Tragweite dieser Idee der Freiheit lässt sich besser erfassen, wenn die verschiedenen Arten, in denen sie eine äußere Grenze darstellt, ein Maximum, im Detail bestimmt werden:
… als Verstoß gegen
die Vernunft …
Es ist nicht nur so, dass der Mensch in allen seinen unfreien Handlungen wie eine Marionette von den Fäden der Natur- und Vernunftgesetze gelenkt wird – „der verwünschten Gesetze“ –, so dass er eine „Klaviertaste“ ist, gleichgültig, anonym, abhängig, wogegen nur die willkürliche Handlung, die Handlung aus einer Laune heraus, anders ist, weil sie die Möglichkeit der Einzigartigkeit und der Identitätsbildung schafft – wir haben auch das extreme Beharren darauf, dass Freiheit notwendigerweise Verstoß gegen Rationalität heißt. In dieser Hinsicht ähnelt diese Vorstellung dem Standpunkt, den vielleicht ein Sohn im Kampf um seine Unabhängigkeit vom Vater einnimmt. Auch einem Sohn scheint vielleicht bloße „Unabhängigkeit“, die Tatsache, seine eigene Entscheidung zu treffen, nicht ausreichend. Er erlebt „wirkliche“ Freiheit nur, wenn er sich in direkter Opposition zu den Wünschen des Vaters befindet. Es ist, als ob nichts seinen Maßstäben genügen könnte, was zu solch demonstrativer Freiheit nicht taugt. Das ist ein wesentlicher Zug in den Ansichten des Untergrundmenschen, den ohne ihn könnten die „Systeme und Theorien“ nicht zu „Staub zertreten“ werden. Das geschieht nur, weil Freiheit für ihn gerade aus Handlungen besteht, die der Vernunft „zuwiderlaufen“ und weil diese Freiheit der „über alles vorteilhafte Vorteil“ ist.
… als absoluter Wert an sich
Diese Idee der Freiheit berührt noch eine andere äußere, nicht zu überschreitende Grenze, wenn er diese Widersetzlichkeit gegen die Vernunft nicht im Namen einer Spontaneität propagiert, die von zu viel Rationalität beschädigt werden könnte, und auch nicht zugunsten einer Emotion oder einer Sensibilität, sondern als absolutes und letztendliches Ziel.
Читать дальше