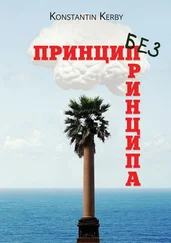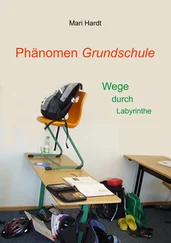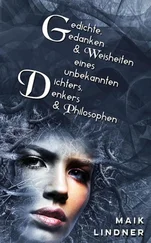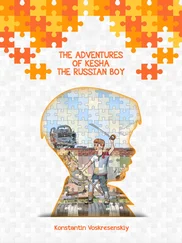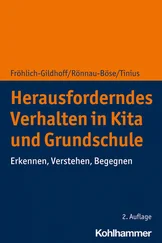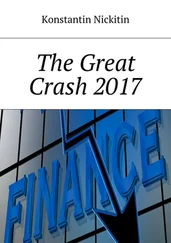Konstantin Lindner - Religionsdidaktik Grundschule
Здесь есть возможность читать онлайн «Konstantin Lindner - Religionsdidaktik Grundschule» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Religionsdidaktik Grundschule
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Religionsdidaktik Grundschule: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Religionsdidaktik Grundschule»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mit seinen grundsätzlichen Klärungen und vielen didaktischen und methodischen Anregungen legt es das Fundament für einen guten Religionsunterricht.
Religionsdidaktik Grundschule — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Religionsdidaktik Grundschule», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Georg Hilger, Werner H. Ritter, Konstantin Lindner, Henrik Simojoki und Eva Stögbauer
I. Religion in der Grundschule – Herausforderungen und Aufgaben
Religionsunterricht erscheint heute einerseits als ein Grundschulfach wie jedes andere auch. Andererseits ist es umstrittener, als dies vor 50 Jahren der Fall war und steht vor zahlreichen Herausforderungen, die von ganz unterschiedlicher Seite an ihn gerichtet werden. Gefragt wird: Was will und soll heute in einer säkular gewordenen Welt religiöse Bildung in der Schule generell? Und was soll der Reiligionsunterricht speziell in der Grundschule bei einer so heterogen gewordenen Schülerschaft, in der nicht wenige Kinder ohne Beziehung zu einer tradierten und gelebten Religion aufwachsen?
Angesichts dieser Situation erscheint uns eines sicher: Im Unterschied zu früher bedürfen Religionsunterricht und religiöse Bildung heute vermehrt der Reflexion, der Begründung und gut gestalteter Praxis. Dies zu entfalten, ist Sache des I. Hauptkapitels.
I.1 Religion und das Recht des Kindes auf religiöse Bildung
Werner H. Ritter/Henrik Simojoki
Der Religionsunterricht bewegt die Gemüter und gelegentlich wird über ihn auch gestritten. Besonders öffentlichkeitswirksam geschah dies vor einigen Jahren in Berlin. Dort wurde am 26. April 2009 über einen Gesetzesentwurf abgestimmt, der eine Fächergruppe Religion / Ethik aus zwei gleichberechtigten Wahlpflichtfächern vorsah. Das hätte eine deutliche Aufwertung des Religionsunterrichts bedeutet, gab es diesen doch nach der Einführung eines verpflichtenden Ethikunterrichts im Jahr 2006 nur noch als freiwilliges Wahlfach. Im Vorfeld dieser Abstimmung kam es zu einer zum Teil erbittert geführten Debatte um diese Frage, in der beide Lager – »Pro Reli« und »Pro Ethik« – die Öffentlichkeit von der Richtigkeit ihrer Position zu überzeugen versuchten. Im vorliegenden Kontext interessiert weniger das Ergebnis dieser Auseinandersetzung – bekanntlich scheiterte das Volksbegehren »Pro Reli« – als vielmehr die Art und Weise, wie sie geführt wurde. Angesichts des erhitzten Diskussionsklimas und der Notwendigkeit, in kurzer Zeit Wählerstimmen für die eigene Position zu mobilisieren, wurde der Streit um den Religionsunterricht schon bald auf der Ebene von Plakaten und Parolen geführt (vgl. WILLEMS 2012a, 56 ff.). Während die Befürworter des Religionsunterrichts mit dem Motto »Werte brauchen Gott« für ihre Sache warben, rieten die Gegner, nur scheinbar gelassen: »Nu’ lasst doch ma’ die Kirche im Dorf!«
An diesem, rückblickend gesehen, unbefriedigenden Prozess öffentlicher Meinungsbildung wird deutlich, dass die Frage nach der Berechtigung religiöser Schulbildung tiefer ansetzen muss. Bevor man sich ins argumentative Für und Wider stürzt, müssen grundlegende Klärungen erbracht werden. Man muss sich darüber verständigen, was es mit dem zentralen Gegenstand dieses Faches, der Religion, eigentlich auf sich hat und wie die schulische Thematisierung von Religion zum allgemeinen Bildungsauftrag der Schule beitragen kann. Daraus ergibt sich der Aufbau dieses Eröffnungskapitels, weshalb die Ausgangsfrage, ob und warum der Religionsunterricht einen legitimen Platz in der öffentlichen Schule hat, erst in einem dritten Schritt erörtert wird (zum ebenfalls konstitutiven Leitbegriff religiösen Lernens s. III.1).
1. Was meint heute Religion?
Wer Religion unterrichten will, sollte wissen, was Religion ist. Das ist aber alles andere als leicht, weil mit diesem Begriff ganz Unterschiedliches ausgesagt werden kann. Während sich Deutsch-, Mathematik- oder Musiklehrerinnen und -lehrer relativ problemlos über den Gegenstand ihres Faches verständigen können, kann im fachlichen Kontext des Religionsunterrichts von einem vergleichbaren Konsens nicht die Rede sein. Während der Religionsunterricht für die eine Religionslehrkraft in erster Linie mit den Überzeugungsgrundlagen ihrer eigenen christlichen Religion zu tun hat, findet die andere Lehrkraft Spuren des Religiösen in der Natur, in der populären Kultur oder auch im kollektiven Jubel auf den Tribünen des Fußballstadions. Wie ein Blick in die gegenwärtige wissenschaftliche Debatte um den Religionsbegriff zeigt, ist die fehlende Übereinkunft in der Sache begründet.
In gewisser Weise kreist die gesamte Religionssoziologie um diese eine, scheinbar simple Frage: Was ist Religion? Eine konsensfähige Antwort steht bis heute aus. Das aber liegt weniger an irgendwelchen Defiziten der Religionssoziologie als vielmehr an der Vielschichtigkeit ihres Gegenstandes. Religion als Phänomen erscheint heute komplex, schillernd und uneindeutig. Jedoch lassen sich in Anlehnung an Gert Pickel (vgl. PICKEL 2011, 18 ff.) immerhin bestimmte konstitutive Elemente unterscheiden, die für Religion charakteristisch sind. Dazu gehören
individuelle Überzeugungen, die sich auf eine höhere Macht, das »Heilige« oder – wie im Christentum – auf einen persönlichen Gott beziehen,
soziale Praktiken, insbesondere in Gestalt von Ritualen und Zeremonien,
eine Gemeinschaft, die über geteilte Überzeugungen, Praxisformen, Verpflichtungen und Normen zusammengehalten wird, und deren
institutionelle Ausprägung im Kontext der Gesellschaft, im Fall des Christentums durch die spezifische Organisationsform einer Kirche.
Bereits hier wird deutlich, dass ein Religionsverständnis, das sich ausschließlich auf den Überzeugungsbereich konzentriert, der sozialen Seite des religiösen Phänomenbestandes nicht gerecht wird. Gleiches gilt für die im christlichen Kontext lange Zeit wirksame Tendenz, Religion mit ihren kirchlichen Ausprägungen zu identifizieren.
Bei dem Versuch, diese grundlegenden Aspekte in einem Religionsbegriff einzufangen, lassen sich grob zwei Richtungen unterscheiden: Substanzielle Definitionen machen Religion an distinkten, als spezifisch religiös geltenden Glaubensinhalten, sozialen Praktiken und institutionellen Manifestationen fest. Das generelle Kriterium für die Religionsbestimmung ist hier der Bezug auf das Heilige oder Transzendente – wo er fehlt, kann von Religion keine Rede sein. Dieser klassische Deutungsansatz ist seit den 1960er-Jahren in die Kritik geraten, hat aber gleichwohl mehrere Vorteile: Er ermöglicht eine klare Abgrenzung gegenüber Nicht-Religion und ist anschlussfähig im Blick auf die Selbstbeschreibungen der Religionsgemeinschaften und das Selbstverständnis der Religionsangehörigen. Problematisch an dieser Definition ist, dass sie viele Phänomene subjektiver, im christlichen Fall: entkirchlichter Religiosität nicht einfängt und nur begrenzt auf nicht-theistische Religionen beziehbar ist.
Demgegenüber definiert der funktionale Religionsbegriff Religion über die Leistungen, die sie für die Gesellschaft, aber auch für das einzelne Individuum erbringt. Nachgerade seit den 1960er-Jahren sprechen Sozialwissenschaftler von verschiedenen Funktionen der Religion wie Identitätsstiftung, Reduktion von Komplexität, Kontingenzbewältigung, ihrer integrierenden Sinngebungs- und Welterrichtungsfunktion etc. Eine inhaltliche oder phänomenologische Festlegung wird bewusst vermieden. Konkrete Überzeugungen, Praktiken oder Gemeinschaftsformen spielen kriteriologisch keine Rolle. Der funktionale Religionsbegriff hat im religionsdidaktischen Kontext den Vorteil, dass er das weite Feld oft latenter Sinnorientierungen einfängt, das unter Kindern und Jugendlichen heutzutage vorzufinden ist. Sein Problem liegt darin, dass die Grenze zwischen religiösen und nicht-religiösen Phänomenen zu verwischen droht. Wenn eine lateinische Messe in gleicher Weise als religiös gedeutet wird wie die kollektive Hysterie auf einem Justin Bieber-Konzert, dann droht der Religionsbegriff seine Unterscheidungskraft einzubüßen. Zudem führt die Vernachlässigung substanzieller Begründungsanteile dazu, dass die geschichtlich bestimmten (Welt-)Religionen in einem bedenklichen Maße zurücktreten.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Religionsdidaktik Grundschule»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Religionsdidaktik Grundschule» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Religionsdidaktik Grundschule» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
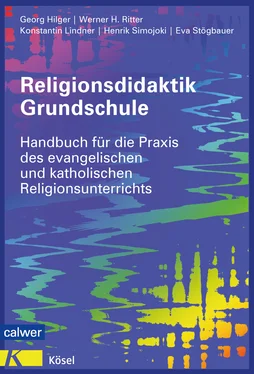
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)