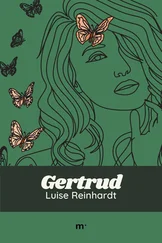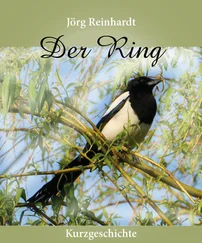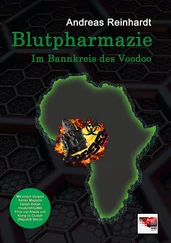Im zweiten Fahrzeug konzentrierte sich der Mann am Steuer auf die Baumkronen und hielt sein Seitenfenster trotz des Regens einen Spalt geöffnet.
Damit stachelte er die Neugier seines französischen Beifahrers an. »Charles, was suchst du da draußen eigentlich? Da bewegt sich doch nichts außer Regen.«
Alarmiert lehnten sich die beiden Männer im Fond nach vorne.
»Genau das macht mir Sorge. Der Wald lebt nicht. Keine Affen, keine Vögel.«
»Ist das alles?«, schaltete sich nun auch der deutsche NGO-Mitarbeiter ein. »Bei dem Sauwetter werden die sich verstecken.«
Charles' Antwort hätte kaum unheilvoller klingen können: »Wir werden seit einiger Zeit beobachtet.«
Bevor einer der anderen Männer etwas erwidern konnte, zerriss ein schnell anschwellendes Brummen die Stille, wie es nur die Propeller-Triebwerke einer schweren Transportmaschine erzeugen konnten. Was dann in niedriger Höhe über sie hinwegflog, ließ alle zusammenzucken.
»Spinne ich, was war das denn?!«, schrie der Beifahrer panisch.
»Eine schwere Transportmaschine in viel zu geringer Höhe«, antwortete der Mann am Lenkrad beiläufig, während er nach einer logischen Erklärung suchte. »Die Maschine muss in diesem Gebiet gestartet oder gelandet sein.«
Für einen kurzen Augenblick hatte Charles eine Transportmaschine vom Typ Iljuschin ausmachen können. Es war so eine, wie sie am Viktoriasee regelmäßig zum Einsatz kamen, genauer gesagt auf dem Flughafen der tansanischen Stadt Mwanza. Doch der lag südöstlich, etwa 650 Kilometer Luftlinie entfernt. Wie viele andere Kongolesen auch, war er im Bilde darüber, dass Mwanza als Zwischenstation für illegale Waffenlieferungen in umliegende Bürgerkriegsgebiete und Länder fungierte, wo Konflikte keine Öffentlichkeit duldeten. Die eigens angemieteten Flugzeuge wurden in Mwanza entladen und nahmen stattdessen zivile Güter für Ziele in Europa einschließlich Russland an Bord. Diesen Zusammenhang behielt Charles jedoch vorerst für sich.
Der Beifahrer studierte die Landkarte und schüttelte ungläubig den Kopf. »Unmöglich, es gibt keine registrierte Landebahn für eine Maschine dieser Größe.« Ungehalten schlug er auf das Papier. »Nichts als dichter Urwald!«
»Dann ist sie eben nicht registriert.« Der Fahrer sah in den Außenspiegel. »Wir haben jetzt ganz andere Probleme.«
Meter um Meter näherten sich zwei Militärfahrzeuge. Das hintere war ein großer geschlossener Geländewagen, erfahrungsgemäß mit mehreren schwerbewaffneten Insassen. Davor fuhr ein Pick-up. An dem Aufbau für das schwere Maschinengewehr hielt sich mühsam ein Uniformierter fest. Insgesamt erkannte Charles modernste Ausrüstung. Tutsi, schoss es ihm in einer Mischung aus Wut und Angst durch den Kopf. Weitere Gedanken folgten:
Die ruandische Tutsi-Armee unter Oberst Kabarere hatte 1997 maßgeblich zum Sieg von Laurent Désiré Kabila im Kongo beigetragen und konnte als Steigbügelhalter für dessen anschließende Präsidentschaft betrachtet werden. Auch für diverse hohe US-Politiker hatte sich dieser Schachzug ausgezahlt, boten sich doch lukrative Sessel in den Aufsichtsräten und Vorständen gewinnträchtiger Grubengesellschaften im Kongo. Doch innerhalb kürzester Zeit hatte dieselbe Tutsi-Armee die Attitüde von Besatzern an den Tag gelegt. Als Nachkommen der hochgewachsenen „Watussi“ aus dem Gebiet südlich von Abessinien, hatten sie ihr Überlegenheitsgefühl gegenüber den Bantu-Stämmen bis nach Kinshasa getragen. Der Grundstein für tödliche Feindschaft war gelegt. Als sich die Armee Ruandas schließlich zurückziehen musste, setzte sie sich gewaltsam und dauerhaft im Osten des Kongo fest. Kabila seinerseits setzte auf die dort verbliebenen Hutu-Milizen der „Interahamwe“ und weitere Gruppierungen, während er in und um Kinshasa blutige Treibjagden auf die gesamte Ethnie der Tutsi organisierte. Wie viele andere Kongolesen in der Hauptstadt, war auch Charles damals über diese Menschenjagd entsetzt gewesen, denn wie so oft mussten unschuldige Zivilisten für fehlgeleitete Machtpolitik sterben.
Ein tiefes Schlagloch holte ihn zurück ins Hier und Jetzt. In der Furcht, er und sein Team könnten zu späten Opfern der Gewaltspirale werden, reagierte er mit wilden Hup- und Lichtsignalen. Die Verfolger hatten bereits gefährlich aufgeschlossen. Endlich erhöhte der Wagen vor ihnen die Geschwindigkeit, was auf der schmalen schlammigen Piste einem Selbstmordversuch nahekam.
Die Männer im Fond sahen wie gebannt durch das Rückfenster. Der Deutsche schrie gegen den Lärm an: »Was sind das für Leute?!«
Charles konnte den Geländewagen kaum noch unter Kontrolle halten. Gesicht und Hemd waren schweißnass. »Vielleicht Männer von General Kirundo!«
»Der Rebellengeneral?!«
»Nach Laurent Nkunda kam Kirundo! Man sagt, er sei noch sadistischer! Meine Leute halten ihn für den Teufel persönlich!«
Auf dem verbliebenen abschüssig-kurvigen Teilstück raste die Kolonne aus Verfolgern und Verfolgten schlingernd bis in das ausgestorben wirkende Dorf Elimbo. Der erste Geländewagen kam rutschend zum Stehen. Matsch wurde meterweit gegen einen verbrannten Mangobaum und auf die zertrümmerten Überreste einstiger Einrichtungsgegenstände geschleudert, die überall verstreut herumlagen.
Joseline Mulolo sprang heraus und rannte wehklagend auf eines der entfernteren Häuser zu. Auf die fordernden Rufe der nachsetzenden Uniformierten achtete sie dabei nicht. Wie ein unbestimmtes Omen ließ der Tropenregen merklich nach, als die übrigen Mitarbeiter der Hilfsorganisation vor ihren Fahrzeugen auf die Knie gezwungen wurden. Keiner der Bewacher fasste sie grob an oder erhob die Stimme gegen sie, was die quälende Ungewissheit noch steigerte. Ängstlich starrten die Gefangenen zu dem Haus, in dem Joseline verschwunden war. Dann vernahmen sie die markerschütternden Schreie der Frau. Als zwei der hochgewachsenen Soldaten sie kurz darauf auf die Straße zerrten, wies sie zur Erleichterung ihrer Kollegen keine Spuren von Misshandlung auf. Stattdessen führte sie apathisch Selbstgespräche in ihrer regionalen Muttersprache, sogar noch, als Francine Magaud ihre Freundin in die Arme schloss.
»Oh, Gott, was hast du gesehen, Kleine. Sag mir doch, was du gesehen hast.«
»Blut, überall Blut. Hier wohnt jetzt der Tod. Mama, Papa, Großmutter …, der Teufel hat euch weggeholt«, übersetzte Charles niedergeschlagen.
Der deutsche Kollege vergrub sein Gesicht zwischen den Armen, während ein Uniformierter per Funkgerät in unbekannter Sprache kommunizierte.
Weiterhin Joseline streichelnd, flüsterte Francine mit gesenktem Kopf. »Was ist hier passiert, und wo sind die Dorfbewohner? Erkennt jemand die Sprache?«
Auch Charles vermied jeden Blickkontakt mit den Uniformierten. Er wusste nun, dass es Tutsi-Rebellen waren. Im Gegensatz zu den Hutu entstammten die Tutsi den hamitischen, nilotischen und äthiopischen Hirtenvölkern. Sie waren häufig von großer hagerer Gestalt, genau wie die hier. Hinzu kam noch die Sprache.
»Das ist Kinyarwanda, die gängige ruandische Sprache«, klärte er mit gedämpfter Stimme auf. »Keine Ahnung, was eine Tutsi-Rebellenpatrouille so weit im Norden zu suchen hat.«
Die drohende Geste eines Bewachers ließ die Gefangenen augenblicklich verstummen. Am anderen Ende des Dorfes bezog ein drittes Rebellenfahrzeug Stellung.
Zwei Stunden später hatte es ganz zu regnen aufgehört, und blutrot kündigte sich der Sonnenuntergang an. Auf der Dorfstraße näherte sich ein Hummer-Geländewagen, der unmittelbar neben den NGO-Fahrzeugen hielt. Die Soldaten nahmen Haltung an. Unter anderen Umständen hätte die Disziplin dieser Männer beeindrucken können. Jede Bewegung schien das Ergebnis eines jahrelangen Drills zu sein. Zügig wurde die internationale Gruppe aus einem der Häuser geführt, in welchem man auf dem Fußboden kauernd ausgeharrt hatte. Sie mussten sich in einer Reihe aufstellen. Nach wie vor wies niemand Spuren von Misshandlungen auf.
Читать дальше