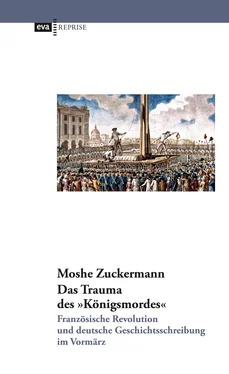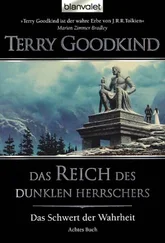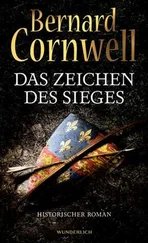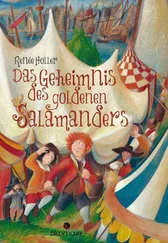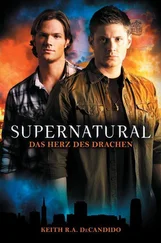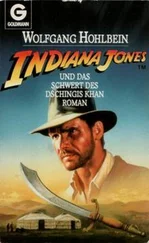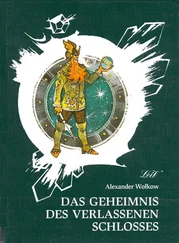Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes
Здесь есть возможность читать онлайн «Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Das Trauma des Königsmordes
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Das Trauma des Königsmordes: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Das Trauma des Königsmordes»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das Trauma des Königsmordes — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Das Trauma des Königsmordes», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Demgegenüber widersetzt sich Furet dem apologisierenden Versuch, die Terrorherrschaft als Funktion notwendiger, unumgänglicher »Umstände« analysiern zu wollen. Ein solcher Ansatz sei eine Art Variante der schon zur Revolutionszeit vorherrschenden »Verschwörungsthese«, welche tendiere, eher Dinge als Menschen zu beschuldigen. Er lehnt sich vor allem gegen die aus dieser Denkweise hervorgehenden Schlußfolgerung auf, daß somit »die historische Initiative zugunsten der Kräfte, die der Revolution feindlich gesonnen sind,« verdrängt werde: »Dies ist der unvermeidliche Preis für einen Freispruch der Revolution hinsichtlich der Schreckensherrschaft.« 123Furet dreht also den Spieß um. Im Grunde – so postuliert er – gehöre die Schreckensherrschaft zur revolutionären Ideologie; diese Ideologie sei es, welche die Bedeutung der »Umstände« steigere, zu deren Entstehen sie aber weitgehend selber beitrage: »Es gibt keine revolutionären Umstände, es gibt nur eine Revolution, die sich aus den Umständen nährt.« 124
Es läßt sich indes behaupten, daß die Rezeption des der Revolution ihr »erschütterndes Kolorit« gebenden Terrors 125 weniger , als es bei anderen Phänomenen der Fall ist, durch den historiographischen »Raschomon« und durch die zeitliche Entfernung vom historischen Ereignis beeinflußt worden sei. Noch Anfang der fünfziger Jahre, d.h. also nach den entsetzlichen Greuel zweier Weltkriege und des Holocausts, verbinden sich für Martin Göhring die Schrecknisse des 20. Jahrhunderts mit dem Terror der Französischen Revolution; nachdem er in seinen Ausführungen die Inquisition und die Hexenverfolgungen kurz gestreift hat, gelangt er zur jakobinischen Phase der Revolution, zu der er feststellt:
»Jetzt entsteht vor den Augen der Welt ein System des Terrors in bisher nicht gekannter Form, auf rein politischer Grundlage, und man entsetzt sich über die blutigen Verirrungen einer großen Nation. Lange hat das Entsetzen angehalten. Inzwischen aber hat die Menschheit andere Schrecken gesehen. Die Bestie ist auchin den Menschen anderer Völker durchgebrochen, sie hat ihre Opfer gefordert, das Recht verhöhnt, Menschen vergewaltigt. Heiligste Güter sind zynisch in den Schmutz getreten und im Namen der Menschlichkeit ist Unmenschliches verübt worden. So beruht die historische Bedeutung der Schreckensherrschaft des Konvents eigentlich in erster Linie darin, der modernen Geschichte das erste Beispiel eines solchen Systems gegeben, gezeigt zu haben, welcher Mittel eine Minderheit sich bedienen kann, um sich und eine Revolution zu verteidigen.« 126
Es geht nicht eindeutig hervor, welche »andere Schrecken« Göhring meint. Bezieht er sich auf den deutschen Faschismus oder etwa auf den sowjetischen Totalitarismus, wie dem Ausdruck »Unmenschliches im Namen der Menschlichkeit« und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung seines Buches, der Zeit des Kalten Krieges, zu entnehmen wäre. Wie dem auch sei, die nebulöse Unklarheit an sich ist schon symptomatisch. Ist doch die Französische Revolution, eines der meisterforschten Themen neuerer Geschichte 127, im Laufe ihrer langen historiographischen Reise zu einer Art Beziehungsfolie geworden, mittels der sowohl die ihr voraufgegangenen Abläufe als auch die nachfolgenden Entwicklungen aufs gegensätzlichste gewertet werden. 128Soboul glorifiziert ihre Großartigkeit als eine gleichzeitig bürgerliche und demokratische Revolution; mit Beziehung auf einen Ausdruck Jaurès’ unterscheidet er sie von ihren englischen und amerikanischen Vorgängerinnen, welche »borniert bürgerlich und konservativ« geblieben seien, und stellt fest: »Ob bewundert oder gefürchtet – die Revolution lebt im Bewußtsein der Menschen weiter.« 129Schon im Jahre 1931 erklärt Eugen Rosenstock-Huessy:
»Die französische Revolution ist noch heute in aller Munde. Zwischen ihr und der russischen Revolution steht die europäische Welt. Der einzelne Europäer muß seinen Standpunkt wählen im bürgerlichen oder im nichtbürgerlichen Lager. Das bürgerliche Lager aber ist das Lager der Ideen von 1789. Es ist das Lager der liberalen Grundsätze von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Der bürgerliche Bewohner unseres Erdteils lebt also unter der Bürgschaft der bürgerlichen Revolution. Aber auch der unbürgerliche Sozialist oder Kommunist oder Bolschewist sieht die Welt im Lichte der Gesellschaftssordnung von 1789. Er bekämpft die bürgerliche Gesellschaft. […] Sie begreift ihm die gesamte Vergangenheit in sich, aus der er die Zukunft herauszuschlagen hofft.« 130
Diese Sicht der revolutionären Auswirkungen verdeutlicht sowohl die Totalität des Einflusses, den die Französischen Revolution auf die heutige Auffassung der politischen und gesellschaftlichen Praxis ausübt, als auch die in ihr enthaltene antizipierende Dimension. Die Antizipation selbst wirkt in zweierlei Richtungen: Das eine historiographische Lager bedient sich der Französischen Revolution als Vergleichsmodell zur Analyse der Gegenwart und zur Wertung des in ihr verborgenen Entwicklungspotentials – die Tendenz dieser Auffassung ist auf die Verhinderung der Reproduktion der Geschichte gerichtet. Im »rationalen« Fall rührt die mit dieser Tendenz einhergehende Furcht von einem Assoziationssystem her, welches (wie es beispielsweise Taine tut) das Verhalten der revolutionären Menge dem eines Betrunkenen gleichsetzt: erst sei er fröhlich, dann euphorisch und brüderlich, schließlich aber zunehmend gewalttätig, irrational und »mordlustig«. Nicht von ungefähr behauptet Vovelle, hinter dieser anthropomorphen Reduktion verberge sich ein Erklärungsmodell, wonach die Menge entweder infantil oder betrunken sei. 131Im »irrationalen« Fall wurzelt die Angst vor der Revolution in einem regressiven Pattern, welches die Revision der Geschichte anstrebt. Die Tatsache, daß neoroyalistische Verfasser, wie Gaxotte oder Aubry, in einem solchen Geiste schreiben, überrascht dabei weniger als die »bedeutende Resonanz«, welche ihren Auffassungen in der Öffentlichkeit zuteil wird. 132In beiden Fällen geht die Assoziation des Infantilen aus der Furcht hervor: Im ersten Fall projiziert sie der Historiker auf seinen Forschungsgegenstand, die Menge; dieses Vorgehen ermöglicht die Distanzierung von eben dieser Menge als einsehbare Konsequenz aus der Delegitimierung ihres mündigen Auftritts auf der Bühne der Geschichte – Kinder haben auf dem Spielfeld der Erwachsenen sozusagen nichts verloren. Im zweiten Fall verharrt das »Infantile« im Historiker selbst, und er flüchtet sich in den nachkonstruierten Schutz eines väterlichen Königs. Die Tatsache, daß der »König«, auch als politisches Paradigma, tot ist und nicht mehr existiert, ist in diesem Zusammenhang von minderer Bedeutung. Wie wir im Verlauf unserer Untersuchung noch zu zeigen haben werden, kann die kollektiv-psychische Realität ungleich persistenter und stärker sein als der Bezug zu Tatbeständen der objektiven Wirklichkeit.
Das zweite historiographische Lager bedient sich der Französischen Revolution zur Antizipation der nachfolgenden Revolutionen. So registriert etwa Guérin eine »evidente« Verbindung »von der Kommune von 1793 zu der von 1871 und zu den Sowjets von 1905 und 1917«. Sacher weiß zwar, daß die Enragés weder Kommunisten noch Sozialisten sein konnten, doch behauptet er, »ihr profunder Egalitarismus« habe sie »zu Vorläufern des Sozialismus« gemacht. Griewank erklärt, die Französische Revolution habe »an der Wiege« des Bürgerkönigtums von 1830, der parlamentarischen Republik von 1848, der bürgerlichen Republik von 1870 wie der Pariser Kommune von 1871 gestanden, und Soboul stellt fest, aus der Französischen Revolution seien Ideen hervorgegangen, die (nach Marx’ Diktum) »›über die Ideen des ganzen alten Weltzustandes‹ hinausweisen: die einer neuen Gesellschaftsverfassung, die nicht mehr die bürgerliche Ordnung sein wird.« 133Aus einem solchen Blickwinkel wird also die Französische Revolution als Meilenstein im Emanzipationsprozeß der Menschheit begriffen, wenn nicht gar als dessen Ausgangspunkt. Sie selbst hat den Menschen zwar nicht von seinen sozialen Zwängen befreien können, aber ihre ideellen und mentalen Ergebnisse – das in ihr verkörperte historische Paradigma – fungieren als Ansätze zukünftiger progressiver Entwicklungen, welche (so die marxistischen Lehre) die soziale Revolution als Manifestation des immerwährenden Klassenkampfes zum Inhalt haben. Aus dieser Perspektive kann Jaurès’ emphatische Deklaration, die Revolution sei noch nicht beendet, als nur zu folgerichtig erachtet werden; ihre Spuren lassen sich jedenfalls in der bis in die Gegenwart hinein andauernden historiographischen Debatte um das Ende der Revolution verfolgen. 134
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Das Trauma des Königsmordes» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.