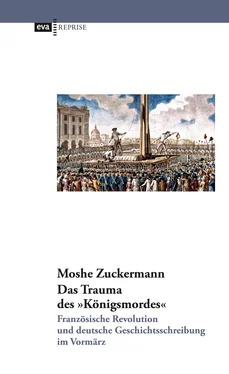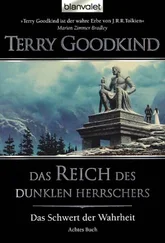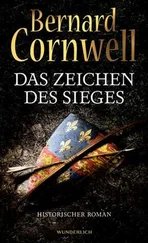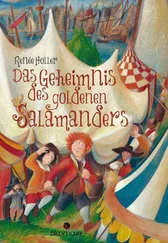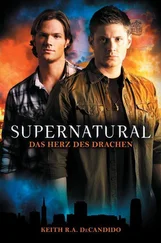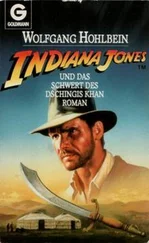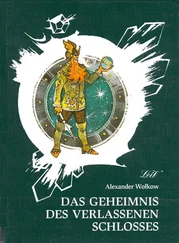Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes
Здесь есть возможность читать онлайн «Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Das Trauma des Königsmordes
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Das Trauma des Königsmordes: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Das Trauma des Königsmordes»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das Trauma des Königsmordes — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Das Trauma des Königsmordes», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Göhring sieht weder die Sansculotten noch eine der anderen radikalen Bewegungen der Revolution als Proletariat an, er weiß jedoch sehr wohl, daß sich mit ihnen eine historische Herausnahme des Wachses aus den Ohren paradigmatisch andeutet. Das Ende der Girondisten betrauert er demgemäß: »Das Ethos des gehobenen Bürgers, der in der Republik die Freiheit zu begründen hoffte, hat keinen Künder mehr; es ist in der Seele getroffen.« 150Dieser Umstand scheint dermaßen bedrohlich zu sein, daß er selbst im nachhinein das Wesen der Begegnung zwischen Marat und Corday durch nichts anderes zu erfassen vermag als durch eine quasi-rassistische Polarisation (»blonde Tochter des Nordens« der »zerfressenen Hülle des Südländers« gegenübergestellt) bzw. durch einen pseudo-religiösen Manichäismus (»das Göttliche« gegenüber »dem Dämonischen«).
Es sei indes wiederum angemerkt: Weder um Göhring noch um einen anderen der erwähnten Historiker persönlich geht es in der vorliegenden Untersuchung. Sie alle gelten uns lediglich als Vermittler historiographischer Botschaften, als Vertreter ideologischer Positionen. Als solche genießen sie jedoch keine Exklusivität, denn wenn schon »die Eule der Minerva […] erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug« beginnt 151, so erwachen Kleos Bären für gewöhnlich erst nach einem ausgiebigen Winterschlaf: Gerade im Fall der Französischen Revolution – jenes offenbar noch keineswegs abgehakten historischen Ereignisses – ist die Beteiligung des Historikers an der Gestaltung des kollektiven Gedächtnisses beschränkten Maßes. Ist er doch selbst (geschweige denn sein Lesepublikum) weitgehend von den positiven wie negativen, oft durch außerwissenschaftliche Kulturinstitutionen vermittelten Mythen der Revolution in seinen Anschauungen »geformt«, in seiner Rezeptionsausrichtung gewissermaßen vorgeprägt. Nicht von ungefähr behauptet Peter Stadler, es sei die Vermutung nicht von der Hand zu weisen, »daß Werke wie Victor Hugos ›Notre Dame de Paris‹ oder Meyerbeers ›Hugenotten‹ (wie auch viele historische Prunkgemälde) die Vergangenheitsvorstellungen eines breiteren Publikums weit nachhaltiger gefärbt haben, als manches repräsentative Geschichtswerk.« 152Eine von G.P. Gooch überlieferte Anekdote kann in dieser Hinsicht als exemplarisch gelten: Er berichtet vom außergewöhnlichen Erfolg der Revolutionsgeschichte Lamartines bei dessen zeitgenössischen Lesern. Der französische Dichter, angesichts einer solchen Räsonanz selber verwundert, wandte sich an Dumas mit der Frage, was wohl der Grund für diesen Erfolg des Werkes sei. »Weil Sie Geschichte auf die Ebene des Romans gehoben haben«, soll dieser geantwortet haben. 153
Mehr noch: Man kann bezweifeln, ob zu viele Franzosen wußten, was sich im Jahre 1789 tatsächlich auf der Bastille zugetragen hatte, als im Jahre 1881 der 14. Juli zum Nationalfeiertag und die Marseillaise zur Nationalhymne erklärt wurden. »Die differenzierende Erklärung des Revolutionsgeschehens wurde zwar den Fachleuten und Historikern überlassen,« meint Diwald, »aber der Revolution selbst wurde durch die Republikaner ein für allemal der höchste Stellenwert in Frankreichs Selbstverständnis verliehen.« 154Das sogenannte »breite Publikum« scheint da also im Besitze einer eigenen Revolutionsmatrix gewesen zu sein. So ist denn der Historiker, soweit er sich nicht im esoterischen Diskurs mit seinen Kollegen einschließt, vor allem Indikator, wenn man will: Symptom des Rezeptionsprozesses. Denn die stürmische historiographische Kontroverse über die Interpretation der Revolution repräsentiert die anhaltende Debatte um das Wesen der Gesellschaft und die in ihr wirkenden Antagonismen. So besehen ist Eberhard Schmitts Wunsch nach einer »abschließenden Geschichte der Französischen Revolution 155illusionär. Die Französische Revolution ist noch immer nicht beendet.
2. KAPITEL
Die Französische Revolution im Spiegel der Kode-Matrix
Der im vorigen Kapitel aufgebrachte Begriff »Kode-Matrix« erfordert eine zusätzliche kurze Anmerkung. Es scheint, als enthalte er eine deterministische Dimension, die da besagt, der Mensch erfasse mitunter die ihn umgebende Realität, aber auch (wie in unserem Fall) die Geschichte mittels Regungen archaischer, in ihm schlummernder »Motiv-Kodes«, die sich seiner Vernunft, seinem Bewußtsein also, entziehen – mit anderen Worten: der Mensch reagiere auf die Welt mythisch. Ohne den Anspruch erheben zu wollen, somit die komplexe und langwierige Geschichte dieses epistemologischen Problems auch nur angedeutungsweise erörtert zu haben, kann man doch darauf hinweisen, daß ein Philosoph wie Jacob Taubes einer solchen Vermutung zumindest partiell zugestimmt haben würde. Stellt er doch fest: »Es ist das Vorurteil der [Historiker-]Zunft, daß mythische Bilder oder mystische Termini vage Orakel seien, biegsam und jedem Willen gehorsam, während die wissenschaftliche Sprache des Positivismus die Wahrheit gepachtet habe. Nichts kann ferner von den wirklichen Verhältnissen sein als dieses historische Vorurteil.« 1Ähnlich meint auch Claude Lévi-Strauss, daß die Interpretation des Mythos, »die sich als umfassend betrachtet und den Anspruch erhebt, Probleme, die von uns als vollkommen unterschiedlich aufgefaßt werden, gleichzeitig und mit einer einzigen Art der Beantwortung angehen zu können«, in unserer Gesellschaft zwar keinen Bestand habe, weil sie nicht imstande sei, die Funktion zu erfüllen, die sie in primitiven Gesellschaften innehatte, aber er fügt hinzu, daß trotz der »Explosion«, welche mit der Aufteilung der Wissenschaften in unterschiedliche Themenbereiche stattgefunden habe, es doch sicher sei, »daß Mythosüberbleibsel überall herumliegen – die Explosion ist doch nicht im Nichts aufgegangen. In verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen und privaten Lebens lassen sich Reste mythischer Auffassungen und mythischen Denkens auffinden.« 2Eli Barnavi illustriert gar mit der Darstellung der Entwicklungsgeschichte des Sallischen Gesetzes den Prozeß der Hervorbringung eines historischen Mythos durch die Geschichte selbst. 3
Es muß also unterschieden werden zwischen dem Anspruch , die Welt (also auch die menschliche Geschichte) vernünftig zu erfassen, und der einem solchen Anspruch fortwährend entgegenwirkenden Anwesenheit mythischer Erkenntnismuster. Zwar intendieren die Menschen nicht die Zulassung solcher Pattern in ihr Denken, und dennoch befinden sich diese in ihm. Dies soll freilich nicht besagen, daß diese »Überbleibsel mythischer Auffassungen und mythischen Denkens« aus dem Nichts auftauchten. Der Mensch selber bringt sie in sich hervor: Mag er dies rational auch nicht beabsichtigen, so befriedigen sie doch gewisse ihm nicht bewußte Bedürfnisse. In der kollektiven Sphäre läßt sich das Phänomen mit dem Marxschen Ideologiebegriff verdeutlichen. »Mit dem Terminus Ideologie bezeichneten Marx und Engels den grundlegenden, wesentlichen Gehalt des bürgerlichen Klassenbewußtseins, d.h. das falsche Bewußtsein der eigenen gesellschaftlichen Situation, der historischen Rolle und Perspektive dieser Klasse, insbesondere die Idee der Ewigkeit der bürgerlichen Verhältnisse«. 4Schon der Ausdruck »falsches Bewußtsein« impliziert das Postulat einer Nichtübereinstimmung zwischen der objektiven, »wahren« Situation des Menschen und dem Modus seines Bewußtseins in Beziehung auf eben diese Situation. Das Funktionale dieser Gegebenheit ist rational im sogenannten »Klasseninteresse« verankert und in »irrationaler« Hinsicht in dem, was Hahn als »Schranke, die [die Bourgeoisie] auch im Denken nicht zu überschreiten vermag«, bezeichnet. 5
Daraus geht allerdings weder der genetische Ursprung dieser »Schranke« noch der Einfluß, den sie auf die Tathandlung ausübt, hervor. Horkheimer bemerkt zwar, die Theorie sei kein Rezept, und das Handeln enthalte »ein Moment, das in der kontemplativen Gestalt der Theorie nicht ganz aufgeht«; aber auch seine Feststellung, daß »zwischen Theorie und Praxis, zwischen Denken und Handeln, eine Art von Notwendigkeit bestehen« könne 6, löst das Problem letztlich nicht, denn die »Notwendigkeit« kann ebenso eine unbewußte Handlung hervorbringen, wie sie andererseits einer bewußten Handlung unterlegt sein mag. Habermas hingegen hebt hervor: »[…] die Verhaltensreaktionen sind stets vermittelt durch die Interpretationen, unter denen die Handelnden aus ihrem Erwartungshorizont […] die ›beeinflußenden‹ Ereignisse auffassen.« 7Diese Behauptung ist für unsere Problemstellung von immenser Wichtigkeit, weil in ihr das a priori Verhältnismäßige an der Art, wie Menschen ihre Welt auffassen, und der sie zur Handlung bewegenden Kodes – zumindest indirekt – zum Ausdruck kommt. Der »Erwartungshorizont« und die Entscheidung, welche »die ›beeinflußenden‹ Ereignisse« seien, stimmen nicht unbedingt mit der der »objektiven Situation« angemessenen Rezeption überein, und dennoch kodifizieren sie die Einstellungen und Handlungsweisen des Menschen. In dieser Bedeutung hat man auch die »symbolische Sinnwelt« zu begreifen, die von Berger und Luckmann als »die Matrix aller gesellschaftlich objektivierten und subjektiv wirklichen Sinnhaftigkeit« definiert wird. »Die ganze Geschichte der Gesellschaft und das ganze Leben des Einzelnen sind Ereignisse innerhalb dieser Sinnwelt.« 8
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Das Trauma des Königsmordes» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.