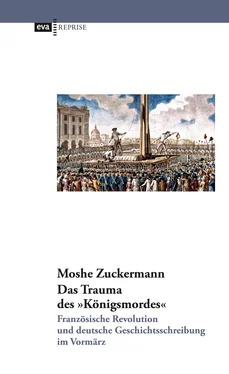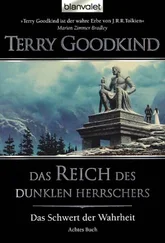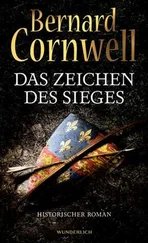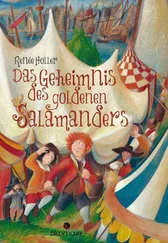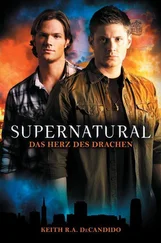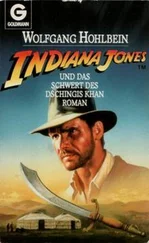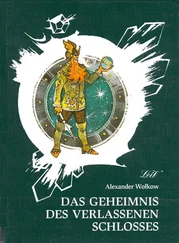Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes
Здесь есть возможность читать онлайн «Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Das Trauma des Königsmordes
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Das Trauma des Königsmordes: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Das Trauma des Königsmordes»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das Trauma des Königsmordes — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Das Trauma des Königsmordes», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Es ist dieser »finalistische« Ansatz, den wiederum Furet der Kritik unterwirft: Obgleich sich offenbar nach der Revolution von 1917 alles geändert habe, projizierten die Historiker der Französischen Revolution ihre Wertung des Jahres 1917 auf die Vergangenheit, indem sie die antizipatorischen Elemente der ersten Revolution hervorheben. Das Ergebnis sei auch nicht zu verkennen: »Die Bolschewisten haben jakobinische Vorfahren, und die Jakobiner nahmen die Kommunisten in gewisser Weise vorweg.« 135Um den Teufelskreis dieser historiographischen Tradition zu durchbrechen, unterscheidet Furet zwischen dem Wertsystem der »linken Kultur« und dem »Verhängnis der kommunistischen Erfahrung im 20. Jahrhundert«; auf dieser Grundlage attackiert er die Verknüpfungbeider Revolutionen unter Verwendung des sowjetischen Totalitarismus als Kriterium:
»Im Jahre 1920 rechtfertigte Mathiez die bolschewistische Gewalt im Namen vergleichbarer Umstände mit dem französischen Vorbild. Heute führt uns der Gulag dazu, la Terreur , die Schreckensherrschaft, wegen einer gewissen Identität der Absichten neu zu überdenken. Die beiden Revolutionen bleiben miteinander verknüpft; aber vor einem halben Jahrhundert wurden sie systematisch freigesprochen, mit einer Entschuldigung, die von den ›Umständen‹, d.h. von äußeren und ihrem Wesen fremden Erscheinungen hergeleitet wurde. Heute beschuldigt man sie im Gegenteil, wesensgleiche Systeme peinlich genauer Zwangsausübung auf Körper und Geist zu sein.« 136
Unserer Auffassung nach ignoriert hier Furet zwei wichtige Gesichtspunkte. Erstens: Es muß darauf hingewiesen werden, daß die russischen Revolutionäre selber der Meinung waren, sie handelten im Rahmen der Tradition der Französischen Revolution. Einige Monate nach der Oktoberrevolution wurde ein Denkmal Robespierres in der Nähe des Kremls errichtet. Die Statue zerfiel zwar bald und wurde nicht wieder aufgestellt; man kann aber Palmers Behauptung zustimmen, daß allein schon die Tatsache der Errichtung dieses Denkmals Lenins Glauben an eine durch den Marxismus vermittelte Verbindung zwischen seiner Bewegung und jener der großen Französischen Revolution bezeuge. Mit der Erinnerung an sie »konnte er an eine lang anhaltende Revolution glauben, an einen Elan der Zukunft, der seine Kraft aus der Vergangenheit schöpft – ein Grundsatz […], der die Oberhand gewinnen muß, weil in ihm der wahre Sinn der Geschichte verkörpert sei.« 137Es läßt sich natürlich behaupten, daß die Überzeugungen der russischen Revolutionäre für die retrospektiven Betrachtungen des heutigen Berufshistorikers irrelevant seien, daß sie ohnehin lediglich ein weiteres Beispiel für die wirklichkeitsfernen Illusionen historischer Akteure abgeben.
Ein solcher Einwand erfordert die Erörterung einer grundsätzlichen Frage: Inwiefern ist der dem historischen Ereignis durch den Historiker beigelegte Sinn der dem Ereignis von den historischen Akteuren zugeschriebenen Bedeutung als überlegen zu erachten? Die Antwort hierauf liegt vermeintlich auf der Hand; der Historiker zeichnet sich durch ein höheres Bewußtsein aus, weil er das empirische Kriterium für die nachfolgenden Abläufe besitzt, er entzieht sich gewissermaßen der den historischen Akteur unweigerlich umhüllenden Kontingenz. 138Es sei hierbei zunächst dahingestellt, inwieweit gerade ein aposteriori-Wissen das Bewußtsein solcherart entstellend zu befrachten vermag, daß eine adäquate Erfassung des historischen Ereignisses nahezu unmöglich wird; wir ziehen es vor, die der Argumentation Furets immanente Logik weiter zu verfolgen: Furet kennt die Entwicklungen in der Sowjetunion seit 1917 und postuliert daher die Notwendigkeit einer Wertungsrevision. Somit wird dem Gulag und dem sowjetischen Totalitarismus die Funktion eines Kriteriums beigemessen, mit dessen Hilfe der revidierten Auffassung der russischen Revolution selber Gültigkeit verschafft wird. Eine solche mechanistische Denkweise ist in der unausgesprochenen Annahme einer Zusammengehörigkeit von Revolution und Gulag verankert, und da nach Furets Auffassung schon der Terror in der Französischen Revolution eine »Entgleisung« (derapage) von der ihr ursprünglich vorgezeichneten Bahn darstellte, verknüpft er selber (assoziativ) den Terror der ersten mit dem der zweiten Revolution, um die von den marxistischen Historikern hergestellte Verbindung zwischen den Revolutionen anzugreifen. Der wesentliche Unterschied ist halt der, zwischen welchen Elementen der Revolution man einen Konnex sucht – und eben darin sehen wir das zweite Versäumnis in Furets Argumentation. Es fragt sich nämlich, ob er seine Ablehnung einer »finalistischen« Verbindung zwischen beiden Revolutionen in gleicher Weise begründet haben würde, wenn sich das sowjetische Regime nach der bolschewistischen Revolution nicht zu dem entwickelt hätte, als was es uns heute erscheint. Wenn wir von einer Verneinung dieser hypothetischen Frage ausgehen, so läßt sich behaupten, daß der sowjetische Totalitarismus höchstens ein historisches Veto ad hoc hinsichtlich der Verwirklichung der Revolutionsziele in diesem (und nur in diesem) Land darstelle, nicht aber eine prinzipielle Widerlegung der Idee der Revolution und der ihr zugrunde liegenden emanzipatorischen Verheißung. Geht man hingegen von der Grundannahme aus, daß die bolschewistische Revolution die nachfolgenden historischen Entwicklungen zeitigen mußte , so manifestiert sich darin eine »finalistische« Argumentation, von der Art, gegen die sich Furet wendet. Wenn man aber eine jegliche Verbindung zwischen den Revolutionen in Absprache stellt, also auch diejenige zwischen ihren positiven (d.h. ihrem Wesen nach emanzipatorischen) Aspekten, so läßt sich die Frage nicht übergehen, welche nun die gültigen Variablen zur Determinierung solcher Verknüpfungen im Rahmen der Geschichte menschlicher Kollektive seien. Warum weist die Variable »Franzosen« oder »Frankreich« eine größere Validität auf, als beispielsweise »Revolutionäre« oder »Revolution«? Anders ausgedrückt: Wenn es akzeptabel erscheint, daß die Französische Revolution in der politischen Tradition des alten Frankreich und seiner politischen Archetypen verankert sei, wie es Tocqueville und in seiner Folge Furet postulieren, so gibt es wohl keinen Grund, die Behauptung zurückzuweisen, die russische Revolution fuße auf der sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts zunehmend verdichtendenden revolutionären Tradition von 1789 bzw. 1793 – und sei es, weil es die russischen Revolutionäre selber so empfanden.
Das diese Revolutionen verbindende Element ist »Freiheit als intentionales Handeln in emanzipatorischer Absicht« 139. Dies ist auch die Bedeutung des Sorelschen Begriffs vom »sozialen Mythos«, welcher »den Menschen zum Handeln bringen« will 140, und in diesem Sinne akzeptiert ihn sogar ein akribischer Forscher vom Schlage Lefebvres; der Mythos bezieht sich auf die Zukunft unter Berufung auf revolutionäre Tathandlungen der Vergangenheit: »[…] die Einberufung der Generalstände war eine ›frohe Botschaft‹: sie versprach die Geburt einer neuen Gesellschaft, in der Gerechtigkeit herrschen und das Leben besser sein würde. Im Jahre II beseelte derselbe Mythos die Sansculotten; in unserer Tradition lebt er weiter und wie 1789 und 1793 ist er revolutionär.« 141Die Verwirklichung des Mythosgehaltes, welcher die Menschen zur revolutionären Tat antreibt, kann – nach dieser Auffassung – nicht als Kriterium für den Geltungsanspruch dieser Tat oder für die Wahrhaftigkeit der ihr zugrunde liegenden Motivationen aufgefaßt werden. Das revolutionäre Kollektiv stellt die Authentik seines emanzipatorischen Bestrebens nicht zur Diskussion und schert sich selten um die potentielle historiographische Rezeption seines Tuns.
So wird denn der Historiker der Revolution zu einer Art »Voyeur«. Für gewöhnlich nimmt er keinen Anteil an der Revolution; er kann sich mit dem revolutionären Akt identifizieren oder ihn ablehnen – so oder so wird für ihn die Revolution zur Matrix , die sich ihm durch die sie zusammensetzenden motivischen Kodes vermittelt. Die von diesen Kodes ausgehenden Stimulationen bewirken den »Kontakt« des Historikers mit der Revolution auf der Basis seiner Weltanschauung, seiner politisch-ideologischen Glaubenssätze und der seiner psychischen Regungen; er gestaltet also den (historiographischen) »Charakter« der Revolution, wobei er auf sie seine Anschauungen, Bekenntnisse, seine Ängste und Hoffnungen projiziert. Unter diesem Gesichtspunkt gibt es zwischen Michelet, der sich »alljährlich« an den »allmächtigen Deuter« seiner Lehre, »den Geist der Revolution« 142, wendet, und Cobban, der daran geht, die von ihm so benannten historiographischen Mythen der Französischen Revolution zu zerstören 143, keinen eigentlichen Unterschied.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Das Trauma des Königsmordes» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.