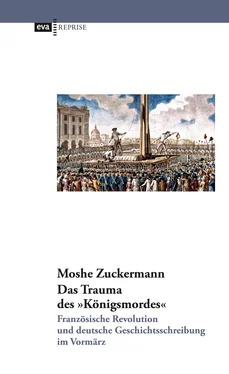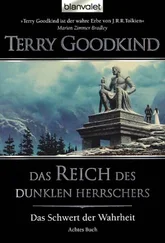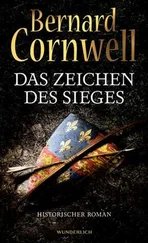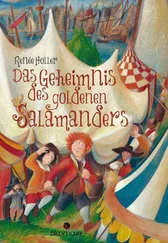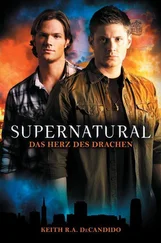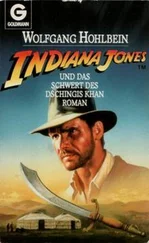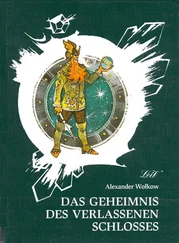Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes
Здесь есть возможность читать онлайн «Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Das Trauma des Königsmordes
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Das Trauma des Königsmordes: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Das Trauma des Königsmordes»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das Trauma des Königsmordes — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Das Trauma des Königsmordes», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Diese primitive Form der Religion, die (wie gesagt) als kulturelle Reproduktion der prähistorischen Begebenheit begriffen wird, bildet für Freud die Ausgangsbasis einer Weiterverfolgung der historischen Evolution der religiösen Institution bis hin zu ihrer entwickeltsten Form, der monotheistischen Religion. 32Jeder Entwicklungsphase liegt jenes Urmuster in verschiedenen Varianten zugrunde, in jeder wird die »Vatersehnsucht« deutlich, so daß die Schlußfolgerung unumgänglich scheint, »daß Gott im Grunde nichts anderes ist als ein erhöhter Vater.« 33Im entscheidenden Moment, als sich das Christentum von diesem Urmuster loszulösen versucht, reproduziert es paradoxerweise die verbrecherische Tat: Jesus opfert sein Leben, um seine Brüder von der Erbsünde zu befreien. Mit diesem Akt wird dem Vater vermeintlich die höchste Sühne geboten.
»Aber nun fordert das psychologische Verhängnis der Ambivalenz seine Rechte. Mit der gleichen Tat, welche dem Vater die größtmögliche Sühne bietet, erreicht auch der Sohn das Ziel seiner Wünsche gegen den Vater. Er wird selbst zum Gott neben, eigetlich an Stelle des Vaters. Die Sohnesreligion löst die Vaterreligion ab. Zum Zeichen dieser Ersetzung wird die alte Totemmahlzeit als Kommunion wiederbelebt, in welcher nun die Brüderschar vom Fleisch und Blut des Sohnes, nicht mehr des Vaters, genießt, sich durch diesen Genuß heiligt und mit ihm identifiziert. […] Die christliche Kommunion ist aber im Grunde eine neuerliche Beseitigung des Vaters, eine Wiederholung der zu sühnenden Tat.« 34
Diese »anthropologische« 35Theorie beschränkt sich nicht auf die historische Rekonstruktion einer hypothetischen Entwicklung der religösen Institution. Dasselbe Gefühl der Ambivalenz, aus dem das Schuldbewußtsein hervorgeht, erweist sich auch als relevant für die Erklärung kollektiver Gefühle von Untergebenen in allen von der Zivilisation hervorgebrachten hierarchischen Situationen, Situationen der »institutionalisierten sozialen und politischen Herrschaft«, wie sie Herbert Marcuse nennt. 36In dieser Hinsicht gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen den kollektiven Psychologien der in Kirche und Heer organisierten »künstlichen Massen«. 37Am deutlichsten drückt sich dies aber in der Beziehung der Untertanen zum König aus, wobei die Tabus eine wiederum tragende Rolle spielen.
Zwei sich ergänzende Grundsätze bestimmen das Verhalten »primitiver Völker« ihren Häuptlingen, Königen und Priestern gegenüber: »Man muß sich vor ihnen hüten, und man muß sie behüten. Beides geschieht vermittels einer Unzahl von Tabuvorschriften.« 38So kann z.B. die Berührung mit dem König einerseits eine gefährliche, ja tödliche, andererseits aber eine beschützende und sogar heilende Bedeutung haben. Solche Vorstellungen und die Notwendigkeit, den König vor den ihn bedrohenden Gefahren zu beschützen, haben eine zunehmende Isolation des Herrschers gezeitigt, und je sakraler die ihm beigemessenen Eigenschaften waren, desto strenger wurden die Isolationsbräuche gehandhabt. So wurden alle Körperteile des Mikados von Japan als dermaßen heilig aufgefaßt, daß man es verhinderte, sie der frischen Luft und den Sonnenstrahlen auszusetzen; es war verboten, sein Kopfhaar, seinen Bart und seine Fingernägel zu schneiden. Ein Nachhall dieses Tabus läßt sich noch in der Beziehung der Römer zum Flamen Dialis, dem Hohepriester Jupiters, finden; nur ein freier Mann durfte sein Haar schneiden, und die geschnittenen Haare sowie seine Nägelabfälle mußten unter einem glückbringenden Baum vergraben werden. Freud erkennt auch in diesem Zusammenhang das gespaltene Verhältnis zum physischen Kontakt mit dem Herrscher: Die vom König ausgehende und in guter Absicht initiierte Körperberührung gilt als schützend und heilend, wohingegen die vom gemeinen Mann am König oder Königlichen verübte Berührung als gefährlich angesehen wird,«wahrscheinlich weil sie an aggressive Tendenzen mahnen kann«. Hieraus ergibt sich die Schlußfolgerung, »daß der Verehrung, ja Vergötterung [der Herrscher] im Unbewußten eine intensive feindselige Strömung entgegensteht, daß also hier […] die Situation der ambivalenten Gefühlseinstellung verwirklicht ist.« 39
Es läßt sich behaupten, daß Freuds Lehre von der Kollektivpsychologie in der Konzeption einer sich zwischen zwei konträr entgegengesetzten Polen bewegenden Gefühlsregung fußt. Der Kampf um die Beilegung dieses Widerspruchs ist es, der die Entwicklung psychischer Mechanismen hervorbringt, in denen die Entstehung zivilisatorischer Institutionen wurzelt, die aber ihrerseits auch wieder ein beredtes Zeugnis von der Fortwirkung der dialektischen Dynamik zwischen den beiden Polen abgeben. In einem solchen umfassenden Sinne gibt es denn auch keinen eigentlichen kollektiv-psychischen Unterschied zwischen den archetypischen Gestalten des Vaters, des Königs und des Gottes. Dieses gesamte theoretische Gebilde würde jedoch ein, wenn auch brillanter, intellektueller Jongleurakt geblieben sein, wäre es nicht mit der ontogenetischen Lehre Freuds verknüpft. Im Grunde bildete sie den Ausgangspunkt für das bisher Dargestellte; es ist demnach kein Zufall, daß Freud die meisten seiner metapsychologischen Schriften in seinen letzten Lebensjahren verfaßte.
Die Mittelachse der psychoanalytischen Theorie ist in der ödipalen Situation als einem ersten »Höhepunkt« in den frühen Entwicklungsphasen des (männlichen) Kindes, wo es seine Mutter begehrt und seinen Vater als Gegner ansieht, verkörpert. Die Kastrationsdrohung zwingt das Kind jedoch, seine Einstellung aufzugeben; es verläßt den ödipalen Komplex, verdrängt ihn und »im normalsten Fall« zerstört ihn gar gründlich, um »als sein Erbe ein strenges Über-Ich« einzusetzen. 40Diese schicksalsträchtige Entwicklung hat zwei zentrale Aspekte: Einerseits stellt sich in ihr der Übergang vom Lust- zum Realitätsprinzip dar; andererseits erwächst aus diesem Übergang selbst eine zusätzliche Schicht im System der menschlichen Psyche. Dieses System läßt sich sodann in folgender komprimierten Form beschreiben: Es besteht aus einem primitiven Es, aus dem sich das Ich abteilt. Jener Bereich im Es, »der mit den Normen des Ichs unvereinbar ist«, bildet den verdrängten Teil der Persönlichkeitsstruktur, wohingegen sich ein anderer Teil des Ichs zum gesonderten Über-Ich entwickelt 41, dem die Funktion des Gewissens beigegeben ist, also die, welche »die Handlungen und Absichten des Ichs zu überwachen und zu beurteilen hat,« und somit »eine zensorische Tätigkeit ausübt«. 42Mit anderen Worten: Wenn sich das Über-Ich als Vertreter der moralischen Forderungen definieren läßt, so vertritt das Ich »Vernunft und Besonnenheit«, das Es hingegen »die ungezähmten Leidenschaften«. 43
Es stellt sich also heraus, daß sich der Lebensraum der Gegensätze im Menschen selbst befindet: Ein animalischer, vorkultureller, gewissermaßen überzeitlicher Teil – jenes chaotische Es, das, vom Lustprinzip angetrieben, die permanente Befriedigung erstrebt – lebt und strömt in ihm; er wird jedoch unentwegt von einem leidvoll gequälten Ich aufgehalten, das widerum durch die objektive Realität der Außenwelt einerseits und durch einen grausam gestrengen Richter in der Gestalt des ihn mit scharfen Ge- und Verboten überschüttenden Über-Ichs andererseits in die Schranken gewiesen wird. Dem Ich wird also die vermittelnde Funktion zugeschrieben, »die Harmonie unter den Kräften und Einflüssen herzustellen, die in ihm und auf es wirken«. 44Die gewaltige Anstrengung und die große Schwierigkeit, die sich mit der Erfüllung dieser Funktion verbinden, machen es klar, was Freud meint, wenn er vom »Unbehagen« des Menschen an der Kultur spricht, und was Marcuse dazu bewegt, die Ersetzung des Lustprinzips durch das Realitätsprinzip als »das große traumatische Ereignis« der sowohl phylogenetischen als auch ontogenetischen menschlichen Entwicklung anzusehen. 45Denn: Freud analogisiert die psychische Ambivalenz, welche die Grundlage für das Verbrechen am Urvater gebildet hatte, mit der, die das Kind in der Phase des ödipalen Konflikts beherrscht; und ähnlich wie die prähistorischen Söhne im Laufe der Zeit durch Verdrängung der Gewalttat einerseits und durch Idealisierung des Vaters bis hin zur seiner Erhöhung zum Gott andererseits reagierten, so verdrängt auch das Kind, nachdem es mit seiner eigenen realen Ohnmacht konfrontiert worden ist, das ödipale Ereignis in den Abgrund seines Unterbewußtseins und »sühnt« die seinem Vater gegenüber empfundene Aggression mit der Bildung jenes Über-Ichs, das dann zunehmend anschwillt, bis es sich zum kompromißlosen psychischen Hemm-Mechanismus ausbildet; die ursprünglich gegen den Vater gerichtete Aggression kehrt in einem Introjektionsprozeß zum Ich zurück, indem sich das sie nunmehr beherrschende Gewissen gegen das Ich richtet. In dieser Weise wird dem Vater ein machtvolles Monument im Über-Ich errichtet, genauso wie am Ende des Prozesses, der zur Schaffung der Religion geführt hatte, der Urvater zum Gott erhöht wurde.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Das Trauma des Königsmordes» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.