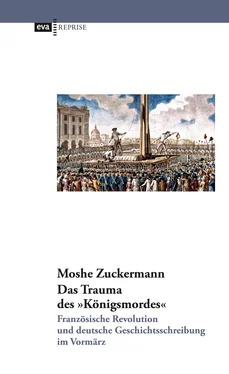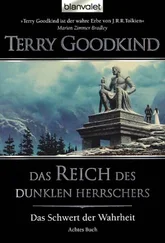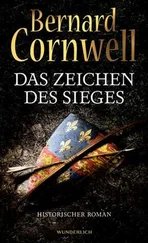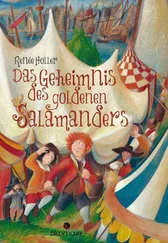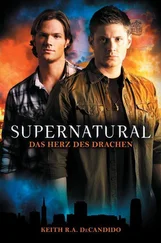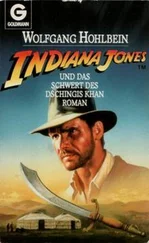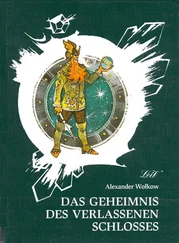Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes
Здесь есть возможность читать онлайн «Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Das Trauma des Königsmordes
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Das Trauma des Königsmordes: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Das Trauma des Königsmordes»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das Trauma des Königsmordes — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Das Trauma des Königsmordes», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Lenkt man die Aufmerksamkeit auf die Hinrichtung des Königs als traumatisches Schlüsselereignis, stellt sich also heraus, daß es eine Übereinstimmung gibt zwischen zentralen Erkenntnissen der Freudschen Lehre und jenen Begriffen, die wir als Hauptkodes der der historiographischen Rezeption der Französischen Revolution unterlegten Matrix beschrieben haben.
Allein schon der Umstand, daß es sich bei dem hingerichteten Monarchen um einen König »von Gottes Gnaden« gehandelt hat, weist darauf hin, wie unerhört dreist die in dieser Tat verkörperte Übertretung des Tabus erscheinen mußte. Die Institution des europäischen Königtums durchlief viele Wandlungen bis es zu einer Form gelangt war, dergemäß die Autorität des Königs aus der ihm von Gott übertragenen Macht resultierte. Die theologische Basis für diese Entwicklung läßt sich zwar schon in den Paulinischen Postulaten, daß es keine Macht außer der Macht Gottes gebe, und daß alles, was der Mensch sei, er infolge der Gnade Gottes sei, finden; Zeugnisse von dem Ausdruck »von Gottes Gnaden« gibt es zwar schon im sechsten Jahrhundert für die lombardischen und im siebten für die angelsächsischen Könige; aber erst im achten Jahrhundert – so Walter Ullmann – wurde dieser Ausdruck zum Titel standardisiert:
»Der König, der bislang durch das Volk oder durch die ihn repräsentierende Körperschaft gewählt worden war, machte es mit dieser Betitelung eindeutig klar, daß sein Königtum auf dem Wohlwollen, der Gunst und der ›Gnade‹ Gottes beruhe. Der wesentliche Punkt ist, daß somit die engen Beziehungen, die er mit dem Volk unterhalten hatte, abgebrochen wurden; das Volk verlieh ihm ja keine Macht mehr, konnte sie ihm demgemäß auch nicht mit legalen Mitteln absprechen, und es war ihm lediglich [zu Gehorsam] verpflichtet.« 58
Ab dem 8. Jahrhundert begann sich also der König allmählich vom Volk zu lösen. Darin lag durchaus eine Umkehrung der ursprünglichen Grundsätze, und es verging doch noch eine recht lange Zeit, ehe sich die papistisch-monarchistische Auffassung durchsetzte, die jegliches Recht der Untertanen, sich der Autorität des Königs zu widersetzen, endgültig untergrub. Die von Ullmann in diesem Zusammenhang erörterten rivalisierenden Theorien der monarchischen Machtvollkommenheit – nach deren ersten das Volk dem König die Macht verleiht (ascending theory), nach der zweiten indes der König seine Autorität der von Gott übertragenen Macht entnimmt (descending theory) – spiegeln jenes ambivalente Verhältnis gegenüber der Institution der Herrschaft wider, welches Freud in den Grundsätzen verkörpert sieht, daß man den König beschützen, sich gleichwohl vor ihm aber auch schützen solle. Das Volk, das seinen König krönt, beschützt ihn, um sich seiner Schirmherrschaft zu versichern; demgegenüber muß man sich vor einem König von Gottes Gnaden hüten, denn er besitzt eine übermenschliche Kraft, und die Berührung mit dem Göttlichen ist verboten: Die Loslösung des Königs vom Volke gerade zu dem Zeitpunkt, als er sich die himmlische Autorität zulegt, wird so verständlich. Die latente Funktion dieser Trennung liegt jedoch im prophylaktischen Schutz vor der potentiellen Aggression der Untertanen, denn gerade die Steigerung der herrschaftlichen Autorität bringt die mögliche Pervertierung des »christlichen Fürsten« zum repressiven Tyrannen mit sich. Nicht von ungefähr tauchten im Laufe der Zeit mannigfaltige Theorien über das Recht zur Auflehnung und zum Tyrannenmord auf. 59
Andererseits wird der König aber auch als wohlwollender Beschützer aufgefaßt. Kraft seiner göttlichen Attribute bekämpft er das Böse, seine Aufgabe ist es, für Frieden und Wohlstand seiner Untertanen zu sorgen. In bestimmten Epochen wird seiner physischen Berührung heilende Wirkung zugeschrieben, und seine Erscheinung erweckt eine fast sakrale Ehrfurcht. 60Der Wille des Königs ist unumstößlich, der Gehorsam der Untertanen geheiligte Pflicht. Die Legitimatonsbasis solcher patriarchalischer Beziehungen steht in engem Zusammenhang mit der göttlichen Legitimation des Herrschers und mit einer Auffassung, wonach das Volk ein einem Kind vergleichbares Kollektivsubjekt darstelle:
»Das Volk selbst, weit davon entfernt, mit autonomer oder angeborener Macht ausgestattet zu sein, wurde sowohl praktisch als auch theoretisch von Gott der Herrschaft des Königs anvertraut bzw. übergeben. Angesichts seiner Unfähigkeit, seine eigenen Angelegenheiten zu meistern, sollte nicht nur die Doktrin das Volk des Königreiches in den juristischen Stand eines minderjährigen Unmündigen versetzen, sondern die köngliche Praxis und Doktrin […] behandelte das Volk bezeichnenderweise als unter dem Munt des Königs befindlich. Der Munt […] drückte also die Idee des Schutzes in der eindrucksvollsten Weise aus. Es war dieselbe Art von Schutz, die der Vater seinem Sohn zuteil werden läßt, in keiner Weise verschieden von dem Schutz, den der Vormund dem Mündel gibt oder im angelsächsischen England der Gatte seiner Frau zu geben pflegte. Der Beschützer wußte angeblich am besten, wann die Interessen seines Mündels Aktion erforderten. […] Dadurch, daß der Beschützer im Besitz des Munt war, unterstand das Mündel, mittelalterlichen Auffassungen gemäß, dessen Gerichtsbarkeit.«
Ein Überbleibsel dieses hierarchischen Verhältnisses findet sich im deutschen Begriff »Vormund«, und Reste seines symbolischen Ausdrucks (wie etwa des erhöhten Throns) lassen sich an Begriffen wie »Royal Highness« oder »Obrigkeit« ablesen. 61
Wir können also behaupten, daß sich in der Entwicklungsgeschichte der monarchischen Institution die Ambivalenz in den Beziehungen zwischen dem König-Vater und den Untertanen-Kindern sowohl in der Sphäre theoretischer Legitimation als auch in der kollektiv-psychischer Introjektion widerspiegelt. Der Rahmen dieser Untersuchung ermöglicht es nicht, den langsamen, evolutionären historischen Prozeß zu verfolgen, der zuletzt dazu führte, daß die Theorie über das Recht der Untertanen zum Tyrannenmord als »häretisch, schimpflich und aufrührerisch«, folglich also »religiös und moralisch irrig« sigmatisiert wurde. 62Es sei indes angemerkt: Am Ende mündete dieser Prozeß im Absolutismus, der in der Gestalt Ludwigs XIV. seinen prägnantesten Ausdruck erhielt. Die Macht des Königs war nunmehr »unbegrenzt«, unter anderem deshalb, weil sich die theokratische Legitimationsbasis zunehmend verfestigte.
Es versteht sich von selbst, daß diese absolutisitische Aureole im Laufe des 18. Jahrhunderts immer mehr verblaßte. Für unser Anliegen ist indes nicht so sehr die objektive Macht des Königs relevant, als vielmehr die Tatsache, daß die Franzosen des Jahres 1789 wohl eine Revolution begannen, in mentaler Hinsicht jedoch recht stark von der historisch bedingten Verinnerlichung der Monarchie als integralen Bestandteil ihrer nationalen und gesellschaftlichen Identität geprägt waren; den Sturz der Monarchie beabsichtigten die Revolutionäre am Anfang gar nicht. Und dennoch ist in der Antwort Mirabeaus an den Zeremonienmeister die erste Auflehnungstat der Revolution gegen die Autorität verkörpert. Unserer Auffassung nach ist es kein Zufall, daß sich dieser symbolische Akt gerade im zeremoniellen Kontext abspielte; stellt sich doch gerade in den Formen des höfischen Zeremoniells jene Tabuvorschrift der Trennung zwischen dem König und seinen Untertanen dar. 63Der Ungehorsam dem Zeremonienmeister gegenüber ist demnach nichts anderes, als eine Übertretung des Tabus und somit ein Akt gegen die Autorität, die es mit diesem Tabu zu schützen gilt. Von diesem Gesichtspunkt aus lassen sich die Geschehnisse in Versailles am 5. und 6. Oktober 1789 ähnlich interpretieren. Einerseits hebt Lefebvre hervor, die Bevölkerung hätte in den Tagen nach diesen Ereignisse dem König Zeichen ihrer »Zuneigung« und Loyalität gegeben, und Michelet behauptet gar: »Alle meinten, daß man niemals Hungers sterben könnte, wenn man den König bei sich habe. Alle waren noch Royalisten und freuten sich sehr, daß sie diesen ›guten Papa‹ endlich in gute Hände geben konnten« 64; andererseits waren jedoch eben diese Ereignisse mit Gewalttaten, bei denen einige von den Leibwächtern des Königs ums Leben kamen, und mit einer schroffen Übertretung der Etikette, in deren Verlauf Leute aus der Menge bis ans Schlafgemach der Königin hervordrangen, verbunden. Das Berührungstabu wurde somit konkret verletzt. Mehr noch, man hat das gesamte Ereignis als einen symbolischen Akt zu begreifen, der einen bedeutungsvollen Wendepunkt schon in den ersten Phasen der Revolution darstellt: Die dem König aufgezwungene Rückkehr zum Zentrum des Geschehens in Paris durchbricht sowohl physisch als auch zeremoniell die traditionelle Trennungsmauer zwischen dem Monarchen und seinen Untertanen – ein Tatbestand, der sich deutlich im grotesken Zug von Versailles in die Hauptstadt manifestiert; von nun an wird der König zwar noch eine Zeitlang »über seinem Volk« stehen, aber er wird unter und mit ihm leben müssen; die so geschaffene physische und mentale Annäherung symbolisiert die ambivalente Bedeutung des gesamten Ereignisses: Das Volk wirbt zwar um die Zuneigung des Königs, es setzt ihn aber auch einer größeren aggressiven Bedrohung als in der Vergangenheit aus. Das Freudengeschrei der hungrigen Fischverkäuferinnen im Laufe ihrer Rückkehr nach Paris, ihre Freude darüber, daß sie »den Bäcker, die Bäckerin und den kleinen Bäckerburschen« heimbringen, enthält demnach zweierlei Botschaften: Wohl kann der König die Not des Volkes lindern, wehe ihm jedoch, man möchte fast sagen: gnade ihm Gott, wenn er es nicht tut.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Das Trauma des Königsmordes» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.