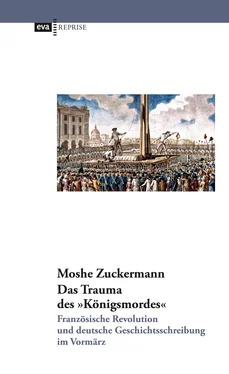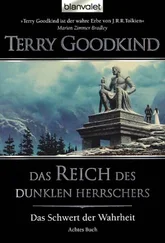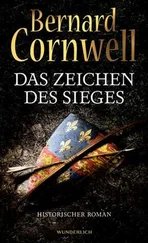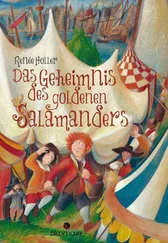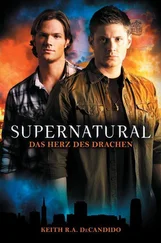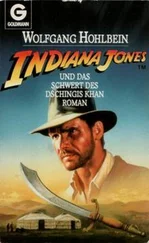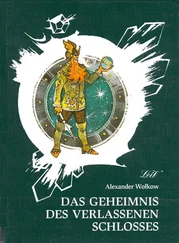Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes
Здесь есть возможность читать онлайн «Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Das Trauma des Königsmordes
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Das Trauma des Königsmordes: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Das Trauma des Königsmordes»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das Trauma des Königsmordes — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Das Trauma des Königsmordes», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Angesichts dieser Gegebenheiten geht man wohl nicht fehl, wenn man der Hinrichtung des Königs, dem konkreten »Vatermord«, die Funktion eines Kriteriums für die Bereitschaft und Fähigkeit der französischen Bevölkerung, den begonnenen politischen Emanzipationsprozeß durchzustehen, beimißt. Der Prozeß des Königs wird somit zu ihrer letzten Prüfung vor der endgültigen Entscheidung über das Schicksal der Revolution. Je näher aber der unumgängliche Entscheidungsmoment heranrückt, desto stärker bricht die Ambivalenz bei den Revolutionären durch, wie sowohl den gegensätzlichen Positionen der Girondisten und der Montagnards als auch der Weise, wie jede der Seiten seine Position der Öffentlichkeit präsentiert, zu entnehmen ist. Robiquets Bemerkung, daß weder die Sitzungen des Konvents noch die langwährende Abstimmung über die Verurteilung des Königs von einer sonderlich »schweren und schmerzerfüllten« Stimmung gekennzeichnet gewesen seien, erfährt eine unserer Darlegung gemäße Deutung, wenn man der Darstellung Gascars folgt:
»So haben die Girondisten durch allerlei Aktivitäten versucht, das Erscheinen des Königs vor der in einen Gerichtshof verwandelten Versammlung hinauszuzögern. Sie hatten zwar selbst die Maßnahme verlangt, fürchten aber nun ihren Ausgang und wagen nicht die Nachsicht, die sie mit dem gestürzten Monarchen haben, konsequent zu vertreten. Die Montagnards dagegen sind zwar entschlossen, ihn zum Tode verurteilen zu lassen, hüten sich jedoch, die Strafe auch offen zu verlangen; sie wissen nur zu gut um den unklaren Respekt, den ein Großteil der Bevölkerung noch immer vor der Person des Königs empfindet. Wegen dieser zwar gegensätzlichen, aber auf beiden Seiten nicht eindeutig zum Ausdruck gebrachten Haltung vollziehen sich der Prozeß Ludwigs XVI. und wenig später die namentliche Abstimmung der Abgeordneten ohne laute, lärmende Debatten in gleichsam schemenhaften Halbdunkel.« 74
Wir meinen, daß die sich in der Äußerungssweise der streitenden Positionen widerspiegelnde Ambiguität mehr als nur politisches Kalkül zum Inhalt hat. Die Tatsache, daß viele der Versammlungsmitglieder ihre Meinung im Laufe der Sitzungen geändert haben, die girondistische Forderung, eine Volksbefragung bezüglich der Urteilsfrage zu veranstalten und die Weigerung der Jakobiner, dieser Forderung nachzukommen, sowie die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Girondisten selbst und die knappen Ergebnisse der Abstimmung – all diese deuten nicht nur darauf hin, daß »die große Mehrheit der Franzosen noch immer Royalisten« waren, sondern auch, daß ein nicht unbedeutender Teil der Volksvertreter selbst vor dem »Odium des Königsmordes« zurückschreckte. 75Soboul hat demnach zwar recht mit seiner Behauptung, daß wenn man den Tag des 10. August nicht verurteilen wollte, man tatsächlich gezwungen gewesen sei, den König für schuldig zu erklären, aber man sollte die Schwierigkeit der Verwirklichung einer solchen zweckrationalen Unumgänglichkeit im Spiegel der Aussagen vieler der Versammlungsmitglieder bewerten, die bezeugten, »wie sehr die Tatsache sie bewegte und erschütterte, daß ein ehemaliger König vor der Vertretung seines Volkes als Angeklagter erschien.« 76
Eine solche Verknüpfung von erklärten politischen Zielsetzungen und (der Ambivalenz Ausdruck verleihenden) emotionalen Äußerungen lassen sich auch deutlich an den Reden der Delegierten im Laufe des Prozesses des Königs ablesen. »Bürger,« ruft Saint-Just am 13. November, »wenn das römische Volk nach sechs Jahrhunderten der Tugend und des Hasses gegen die Könige, wenn Großbritannien nach Cromwells Tod das Königtum trotz seiner Energie wieder aufleben sahen, was müssen bei uns nicht die guten Bürger, die Freunde der Freiheit fürchten, wenn sie das Beil in unsern Händen zittern sehen, wenn sie ein Volk erblicken, welches am ersten Tag seiner Freiheit vor der Erinnerung an seine Ketten Scheu hat! Welche Republik wollen Sie mitten unter unsern innern Kämpfen und unserer gemeinsamen Schwäche errichten?« 77
Die rhetorische Frage, die den Delegierten das Irrationale ihrer Reaktion auf den möglichen Tod des Königs vor Augen führen soll, deckt gerade jene Sphäre auf, die sich eines rein rationalen Zuganges entzieht. Die Hand zittert, weil sie das Beil zur Vollbringung einer Tat führen soll, der gegenüber das Herz zwiespältig empfindet; sie kann diese Tat nicht wie selbstverständlich ausführen, genauso wie der Schwenker des Beils seine Freiheit nicht auf Befehl zu empfinden vermag, eben weil er sich mit der psychischen Realität von Erinnerungen, die ihn paralysieren, auseinanderzusetzen hat. Es handelt sich demnach um den Versuch, die Ambivalenz zu überwinden, wenn Saint-Just feststellt: »Dieselben Menschen, welche Ludwig richten sollen, haben eine Republik zu gründen; diejenigen, welche der gerechten Bestrafung eines Königs irgendwelche Wichtigkeit beilegen, werden niemals eine Republik gründen.« 78Ähnlich stellt auch Jacques Roux das Problem als eine Dichotomie ohne möglichen Zwischenweg dar: »Entweder fällt Louis’ Kopf oder wir werden uns unter den Trümmern der Republik begraben.« 79Es erhebt sich die Frage, warum es die Revolutionäre so sehen. Welchen Schaden kann schon der gestürzte und eingesperrte Ludwig noch verursachen? Die Antwort hierauf dürfte klar sein: Nicht in seiner Fähigkeit zu handeln und zu schaden liegt Ludwigs Macht, sondern in der Art, wie die durch ihn verkörperte Institution verinnerlicht worden ist; die ihm durch die psychische Realität verliehene Macht ist ungleich größer als seine objektive. Dies fühlt offensichtlich auch Robespierre, als er im November 1792 behauptet: »Bürger, wenn es euch schwerer fällt, einen König zu bestrafen als einen schuldigen Bürger zu belangen; wenn eure Strenge in umgekehrtem Verhältnis zur Größe des Verbrechens und zu der Schwäche des Verbrechers steht, dann seid ihr noch sehr weit von der Freiheit entfernt; dann besitzt ihr noch immer die Seele und die Vorstellungen von Sklaven.« 80
Die Seele von Sklaven ist die Seele von Menschen, die in einen repressiven Zustand hineingeboren wurden, die die Freiheit nicht als eine Grunderfahrung verinnerlichen gelernt und daher eine psychische Verfassung der Abhängigkeit entwickelt haben. Sklaven sind fast so machtlos wie Kinder; Robespierres rügende Worte spiegeln also ein objektives Paradox wider: Er wendet sich an die Versammlungsmitglieder als rationale Erwachsene, ahnt jedoch auch, daß sie in der Zwickmühle der Ambivalenz eingezwengt sind. Er muß daher seine Zuhörer in einen quasi prämoralischen Zustand versetzen: »Wenn eine Nation gezwungen gewesen ist, auf das Recht des Aufstandes zurückzugreifen, tritt sie dem Tyrannen gegenüber in den Naturzustand zurück.« Und in diesem Sinne erhält die Beziehung zum König eine neue Bedeutung: »Es gibt hier keinen Prozeß zu führen. Ludwig ist kein Angeklagter. Ihr seid keine Richter. Ihr seid lediglich Vertreter des Staates und Repräsentanten der Nation und könnt auch nichts anderes sein. Ihr habt kein Urteil für oder gegen einen Menschen zu fällen, sondern eine Maßnahme im Interesse der Öffentlichkeit zu ergreifen und einen Akt auszuführen, der für das Schicksal der Nation bedeutungsvoll ist.« 81Im Naturzustand gibt es kein Gewissen und keine herkömmliche Moral, sondern ein natürliches Recht zur Auflehnung; ein solcher Zustand ermöglicht auch die Verwendung mythischer Bilder, um die Gestalt des Vaters zu eliminieren und die Erinnerung an ihn auszumerzen: »Die Völker richten nicht auf die gleiche Weise wie die Gerichtshöfe; sie fällen keine Urteile, sondern sie schleudern Blitze; sie verurteilen die Könige nicht, sondern werfen sie ins Nichts zurück«. 82Robespierre weiß aber auch, daß sich das Problem vor allem in den Revolutionären selbst befindet; er wendet sich daher an die Girondisten: »Man sagt, es handele sich um einen Fall von größter Bedeutung und man müsse mit Weisheit und bedächtiger Umsicht urteilen. Aber ihr allein seid es, die einen großen Fall daraus machen. […] Ihr macht einen großen Fall daraus, aber was findet ihr daran eigentlich so groß? […] Was ist das Motiv dieser ewigen Verzögerungen, die ihr uns anempfehlt?« Er beantwortet die Frage selber, indem er den Spieß umdreht und jene Argumentationslinie gebraucht, die er späterhin heranziehen wird, um sich dann allerdings der Volksbefragung zu widersetzen: »[…] als ob das Volk eine gemeine Herde von Sklaven wäre und einfältig an einen hinterhältigen Tyrannen noch hinge, nachdem es ihn längst verbannt hat, und als ob es sich um jeden Preis in Niedrigkeit und in Knechtschaft wälzen wollte. […] Ihr glaubt also noch an die eingeborene Liebe zur Tyrannei?« 83Es ist ganz und gar nicht klar, ob sich Robespierre selber dessen sicher ist, daß sich das Volk schon von seiner traditionellen Loyalität dem Monarchen gegenüber emanzipiert habe; er wendet sich an die Delegierten, als sähe er die traumatischen Auswirkungen der Hinrichtung des Herrschers voraus, als wüßte er um die psychologische Bedeutung der Verdrängung: »Warum erscheint uns etwas klar, was uns später dunkel vorkommt?« Der Fragende kennt anscheinend die Antwort; er ahnt, daß das Gedächtnis dem Gewissen nachgibt; er ist daher bestrebt, die Revolution im Gewissen selbst hervorzurufen: »[…] ihr stellt immer noch die Person des Königs zwischen uns und der Freiheit! Im Namen unseres Gewissens sollten wir uns davor fürchten, zu Verbrechern zu werden; wir sollten fürchten, daß wir uns selbst an die Stelle des Schuldigen setzen, wenn wir ihm zu viel Nachsicht erweisen.« Als Beispiel gibt Robespierre sich selber – er habe es geschafft, sich vom König emotional zu lösen: »[…] ich empfinde für Ludwig weder Liebe noch Haß; ich hasse nur seine Missetaten.« Aus all dem folgert er also: »Ludwig muß sterben, weil das Vaterland leben muß.« 84
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Das Trauma des Königsmordes» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.