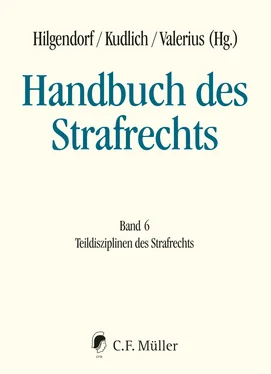c) Fehlen des Pflichtwidrigkeitszusammenhanges
156
Hierfür genügt es im Übrigen, wenn auf Tatsachen gestützte, mehr als nur theoretische Zweifel daran verbleiben, dass ein pflichtgemäßes Verhalten den Erfolgseintritt verhindert hätte.[963] Abweichend hiervon will Roxin nach dem von ihm entwickelten „ Risikoerhöhungsprinzip“[964] – im Falle des Unterlassens: Risikoverminderungsprinzip[965] – den Täter auch dann für den Erfolg verantwortlich machen, wenn er das Risiko für den Eintritt dieses Erfolges erhöht hat, ohne dass feststeht, dass der Erfolg bei einem pflichtgemäßen Verhalten des Täters mit Sicherheit ausgeblieben wäre. Die objektive Zurechnung des Erfolges soll also bereits dann erfolgen können, wenn das Verhalten des Täters zu einer gegenüber der Normalgefahr gesteigerten Gefährdung des Angriffsobjekts geführt hat, weil die jeweils in Betracht kommenden Sorgfaltspflichten auch zu beachten seien, wenn nicht sicher sei, ob dadurch Gefahren vermieden würden.[966] Bei Anwendung dieser ebenfalls Kausalität und Risikozusammenhang voraussetzenden Risikoerhöhungslehre wäre zwar der Grundsatz „in dubio pro reo“ nicht verletzt,[967] der nach dieser Auffassung eben erst dann eingreift, wenn zweifelhaft ist, ob durch das sorgfaltswidrige Verhalten eine wesentliche Erhöhung des Risikos eingetreten ist oder nicht. Bei der Erfolgszurechnung kann aber weder die bloße Feststellung, dass eine Pflichtverletzung vorlag,[968] noch der Umstand, dass ein erhöhtes Risiko geschaffen wurde, für sich genommen genügen: Der Erfolg würde sich dann lediglich als Reflex der verletzten Schutznorm darstellen.[969] Notwendig ist vielmehr die Feststellung, dass das geschaffene Risiko sich in einem Erfolg realisiert hat,[970] da sonst letztlich Erfolgs- in Gefährdungsdelikte umgedeutet würden.[971]
2. Schutzbereich der verletzten Sorgfaltspflicht[972]
157
Auch im Arztstrafrecht gilt der allgemeine Grundsatz fahrlässiger Erfolgsdelikte, dass eine Zurechnung des Erfolgs nur möglich ist, wenn sich gerade die durch die mangelnde Sorgfalt des Täters gesetzte Gefahr im eingetretenen Erfolg realisiert hat[973] und der Erfolg in den Schutzbereich der verletzten Sorgfaltspflichtfällt. Ein Erfolg, der auf ein sorgfaltswidriges Verhalten zurückgeführt werden kann, ist dem Täter dann nicht zurechenbar, wenn die verletzte Sorgfaltspflicht nicht den Zweck hat, Erfolge der herbeigeführten Art zu verhindern.[974]
a) Zeitliche Differenz des Erfolgseintritts
158
Im Bereich des Arztstrafrechts wird der Aspekt des Schutzzwecks der verletzten Sorgfaltsnorm insbesondere bei einer zeitlichen Differenz beim Erfolgseintrittrelevant. So hätte im Falle von BGHSt 21, 59[975] die vom Zahnarzt unterlassene Voruntersuchung der zu narkotisierenden, an einer Myokarditis leidenden Patientin durch einen Internisten einige Tage in Anspruch genommen, so dass der Todeserfolg – die Patientin starb infolge ihrer nicht erkannten Herzmuskelschwäche an der Vollnarkose – erst entsprechend später hätte eintreten können; ob der Internist die Herzschwäche erkannt hätte, war nicht mit hinreichender Gewissheit zu klären. Aber: Die Pflicht zur Untersuchung hatte nur den Zweck, die Narkosefähigkeit der Patientin zu klären und damit deren Leben und Gesundheit zu schützen, nicht aber, das Leben der Patientin gerade um die Dauer der Untersuchung zu verlängern; insoweit liegt also keine spezifische Pflichtverletzung vor.[976] Anders ist hingegen zu entscheiden, wenn statt einer Operation eine andersartige und weniger gefährliche medizinische Maßnahme (bspw. eine konservative Behandlung) mit dem Ziel einer Lebensverlängerung angebracht gewesen wäre. Hier kann dem Arzt der tödliche Ausgang der verfrühten Operation auch dann als fahrlässige Tötung zur Last gelegt werden, wenn feststeht, dass durch die konservative Behandlung die später durchgeführte Operation letztlich doch nicht hätte umgangen werden können und sie dann mit dem gleichen Risiko wie die jetzige belastet gewesen und unter Umständen ebenso tödlich ausgegangen wäre.
159
Die Frage, worin die spezifische Schutzrichtung der verletzten Sorgfaltsnormzu sehen ist, kann allerdings Schwierigkeiten bereiten.[977] Dies belegt bspw. die Entscheidung von BGH JR 1989, 382:[978] Der Arzt hatte bei einem Säugling einen Leistenbruch auf der falschen Seite operiert. Bei der Anschlussnarkose, die zur Korrektur dieses Behandlungsfehlers erforderlich war, kam es zu einem letztlich ungeklärten tödlichen Zwischenfall. Hier ist zu fragen, ob die ursprünglich unterlassene Untersuchung zur Feststellung der Operationsseite dem Lebensschutz oder dem Schutz der körperlichen Integrität dient. Da nur Letzteres in Betracht kommt, kann dem Täter der bei der zweiten Narkose eintretende Tod dann nicht zur Last gelegt werden,[979] wenn nicht auszuschließen ist, dass dieser Erfolg auf ein nicht feststellbares Herzleiden zurückzuführen war.
b) Dazwischentreten Dritter
160
Insoweit könnte die Zurechnung des hierdurch bewirkten weiteren Erfolgs zum Verhalten des erstbehandelnden Arztes infolge des Verantwortungsprinzips[980] zu verneinen sein.[981] Wie auch sonst in Problembereichen der objektiven Zurechnung kann sich ein Arzt jedoch auf spätere Fehler anderer grundsätzlich nicht berufen. Unter Normzweckgesichtspunkten ergibt sich diese Lösung der „schwierigsten und ungeklärtesten Fallgruppe“ (objektiver Zurechnung)[982] aus folgender Überlegung:[983] Der unerwünschte Erfolg kann gerade auch bei dem Versuch der Abwendung einer vom Täter geschaffenen Gefahreintreten. Auch aus diesem Grund ist diese Begründung (der Ausgangsgefahr) verboten. Dies steht nicht im Widerspruch zum zurechnungsbegrenzenden Verantwortungsprinzip, aus dem lediglich folgt, dass man prinzipiell nicht darauf zu achten hat, dass Dritte Rechtsgüter nicht gefährden. Im vorliegenden Zusammenhang geht es aber darum, dass der Täter selbst pflichtwidrig eine solche Gefahr geschaffen hat und er daher von seiner Verantwortung für das weitere Geschehen nicht schon deshalb frei werden kann, weil später auch andere falsch gehandelt haben.[984] Wie auch sonst ist es insoweit unerheblich, ob der nachfolgend tätige Arzt pflichtwidrig die Realisierung der vom Täter geschaffenen Gefahr lediglich nicht verhindert (bspw. stirbt der vom erstbehandelnden Arzt fahrlässig im Krankenhaus Infizierte, weil der zur Bekämpfung dieser Infektion herangezogene weitere Arzt dem Patienten das erforderliche Medikament fälschlich in einer zu geringen Dosis verabreicht) oder ob der Dritte den in der Täterhandlung ohnehin schon angelegten (Todes-)Erfolg – etwa eine innere Verletzung, die allmählich zum Verbluten führen würde – durch eine positive Maßnahme (sorgfaltswidriges Verhalten beim Heilungsversuch) herbeiführt.[985] Zum groben Behandlungsfehler seitens des nachbehandelnden Arztes sogleich in Rn. 161.
161
Es ist also mit der herrschenden Lehre[986] wie folgt zu differenzieren:[987] Zwar vermag den Täter ein Fehlverhalten Dritter bei ihren Bemühungen, die Realisierung der vom Täter geschaffenen Gefahr abzuwenden, grundsätzlich nicht zu entlasten, da der von Rechts wegen missbilligte Erfolg, den abzuwenden die vom Täter übertretene Verhaltensvorschrift bezweckte, erfahrungsgemäß gerade auch (erst) bei der gleichsam herausgeforderten Abwehr der vom Täter geschaffenen Gefahr eintreten kann. Die Haftung des Ersthandelnden entfällt nur für Gefahren, die nicht mehr im Rahmen der von ihm gesetzten Ausgangsgefahr liegen.[988] Dies ist – allgemein gesprochen – bei grob sachwidrigem Verhalten des Drittenangesichts des hierdurch bewirkten deutlichen Übergewichts seines Erfolgsbeitrags[989] der Fall:[990] Dem erstschädigenden Arzt sind mithin spätere ärztliche Behandlungsfehler solange zuzurechnen,[991] als sich der Tod oder die erschwerte Verletzung des Patienten noch als eine Verwirklichung der von ihm pflichtwidrig geschaffenen Gefahr darstellt.[992] Eine Zurechnung entfällt erst bei grob pflichtwidrigem Verhalten des zweitbehandelnden Arztes[993] (egal ob dieses in einer Fehlmaßnahme oder im Nichtstun besteht).[994] Zurechnung ist auch dann nicht gegeben, wenn nach völliger Beseitigung des Erstrisikos der Patient Opfer eines von Dritten neugesetzten Risikos wird,[995] also bspw. dann, wenn die Zweitoperation zwar erfolgreich die vom Erstbehandelnden geschaffene Gefahrenquelle beseitigt hatte, der Patient dann aber bei einem weiteren, zur Heilung eines anderen Leidens durchgeführten Eingriff verstirbt, der anlässlich dieses erneuten Krankenhausaufenthalts durchgeführt wurde;[996] dies gilt auch dann, wenn dem nachbehandelnden Arzt insoweit ein grober Behandlungsfehler unterläuft.[997]
Читать дальше