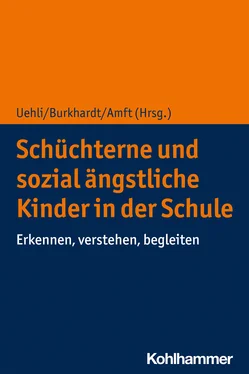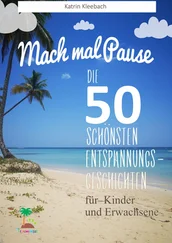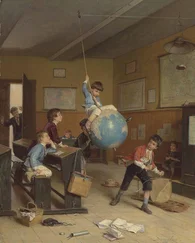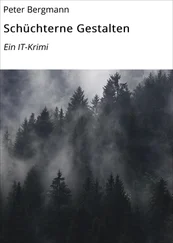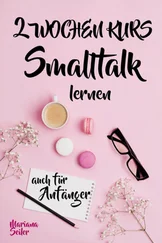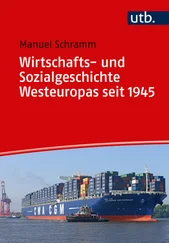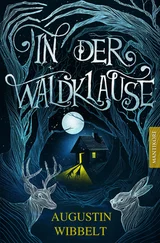Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule
Здесь есть возможность читать онлайн «Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
2.2 Psychische Risikofaktoren
Insbesondere zwei Aspekte sind von Bedeutung. Das oben bereits ausgeführte Temperamentsmerkmal Verhaltenshemmung, welches biologische und psychische Anteile aufweist, sowie kognitive Faktoren.
Temperamentsmerkmal Verhaltenshemmung
Eine aktuelle Studie von Poole & Schmidt (2020) betrachtet schüchterne Kinder im Hinblick auf zwei Subtypen, die auf Buss (1986) zurückgehen. Diese Studie gibt neue, differenzierende Hinweise auf das Temperamentsmerkmal Verhaltenshemmung. Der eine Subtyp wird als ängstliche Schüchternheit bezeichnet und entwickelt sich früh im Kleinkindalter; der andere Subtyp wird verlegene Schüchternheit genannt und beginnt in der frühen bis mittleren Kindheit. Untersucht wurden Verhaltensunterschiede sowie biologische Korrelate (Speichel-Cortisol und frontale Hirnaktivität) bei diesen beiden Subtypen. Bei den Verhaltensunterschieden standen für die ängstliche Schüchternheit die Verhaltensmerkmale Gehemmtheit, Erstarren und Flucht im Fokus, für die verlegene Schüchternheit die Verhaltensmerkmale Beschämtheit, geringe Selbstwirksamkeitserwartung und physiologische, autonome Reaktionen wie Erröten und erhöhte Herzrate. Die Ergebnisse unterstützen das Schüchternheitskonzept von Buss (1986). So weisen verlegen schüchterne Kinder höhere Beschämtheitswerte in videodokumentierten Verhaltensproben mit einer Selbstpräsentations-Aufgabe auf im Vergleich zu ängstlich schüchternen und Kontrollgruppenkindern. Dies ist erklärbar aufgrund der typischen Entwicklung von sozialen Kognitionen in der mittleren Kindheit. Auch auf biologischer Ebene zeigten sich interessante Unterschiede: Bei verlegen schüchternen Kindern wurde eine größere physiologische Erregung, gemessen im Speichel-Cortisol, einem Stresshormon, festgestellt. Bei ängstlich schüchternen Kindern fiel die α-Asymmetrie im Ruhezustand bei der EEG-Messung auf, was auf die generell erniedrigte Erregungsschwelle im limbisch-hypothalamischen System verweist. Diese ängstlich schüchternen Kinder geraten also vom Kleinkindalter an schnell in einen körperlichen Erregungszustand, wenn sie sich in einer bedrohlichen, subjektiv angstauslösenden Situation zu befinden glauben. Solche Situationen sind an unvertraute Umgebungen und fremde Personen geknüpft. Diese Studienergebnisse von Poole und Schmidt (2020) sprechen dafür, dass es zwischen Verhaltenshemmung und ängstlicher Schüchternheit eine hohe Überlappung gibt, was die hohe Stabilität von Vermeidungsverhalten und Sensitivität für angstauslösende Situationen erklären könnte.
Kognitive Faktoren
Die kognitiven Merkmale sozial ängstlicher Kinder und Jugendlicher können als typisch bezeichnet werden und zielen vor allem auf Aspekte
• der subjektiven, verzerrten Wahrnehmung,
• der negativen, irrationalen Gedanken,
• der ungünstigen Kausalattributionen,
• der geringen Selbstwirksamkeitserwartung,
• dem negativen Selbstbild und
• der hohen Selbstaufmerksamkeit.
Die kognitiven Faktoren machen sich vor allem in den sozialen Situationen bzw. in vorweggenommenen sozialen Situationen bemerkbar. Wahrscheinlich bedingt durch die generell erhöhte soziale Ängstlichkeit sowie durch Erfahrungen in früheren sozialen Situationen sind die Wahrnehmung und Gedanken verzerrt. Zweideutige soziale Reize, auch neutrale Signale in einer sozialen Situation werden als bedrohlich wahrgenommen. Damit unterliegen sie einer subjektiven Interpretation und lösen Ängste aus.
Die Gedanken und Selbstgespräche sind negativ und kreisen immer wieder um Versagen, Abgelehnt-Werden sowie Scham- und Schuldgefühle. Nie sind es die ungünstigen Umstände oder andere Personen, wenn etwas nicht klappt, sondern man selbst schreibt sich die Schuld für ein nicht erfolgreiches Ereignis beziehungsweise Handeln zu.
Selbstzweifel und mangelnde Selbstwirksamkeitserwartungen spiegeln große Selbstwertprobleme und ein negatives Selbstbild wider. Dieses negative Selbstbild trägt entscheidend zur Aufrechterhaltung der sozialen Angst bei Kindern und Jugendlichen bei. Chapman et al. (2020) haben zur genaueren Einschätzung dieses Zusammenhangs einen systematischen Review angefertigt. Bei ihrer Recherche fanden sie neun Studien, die die Bedeutung des Selbstbildes für soziale Ängstlichkeit bestätigen und unterstreichen, wobei sich nur zwei Studien auf das Kindesalter bezogen.
Letztlich führt die Gesamtheit aller genannten negativen kognitiven Prozesse zu einer erhöhten Selbstaufmerksamkeit, die von der eigentlichen Aufgabe oder von der Konzentration auf eine soziale Situation ablenkt. Die hohe Selbstaufmerksamkeit verstärkt wiederum die verschiedenen ungünstigen kognitiven Prozesse. Zudem führt die erhöhte Selbstaufmerksamkeit auch dazu, dass die autonomen Körperreaktionen (wie beispielsweise Erröten, Schwitzen, pochendes Herz) bewusst wahrgenommen werden (Clark & Wells, 1995). Das Registrieren der erhöhten körperlichen Erregung verstärkt wiederum diese sympathische Aktivität. Die erhöhte Selbstaufmerksamkeit führt also insgesamt dazu, dass verzerrte Wahrnehmungen, irrationale Gedanken und negative interne Kausalattributionen von einem ängstlichen Kind und Jugendlichen nicht unter Kontrolle gebracht werden können. Damit verringern sich über die Zeit die Selbstwirksamkeitserwartungen weiter. Innere Sätze wie »das lerne ich nie; das kann ich sowieso nicht; das schaffe ich nicht; ich bin nicht so schlau wie die anderen; ich bin nicht so mutig wie die anderen« sind für diese Kinder und Jugendlichen typisch wie auch das Selbstbild prägend (Petermann & Petermann, 2015).
Neben der mehrfach geteilten Aufmerksamkeit, also zum einen negative Gedankenkaskade, zum anderen Spüren der körperlichen Veränderungen und drittens dem Versuch, sich auf die Situations- und/oder Aufgabenbewältigung zu konzentrieren, erschwert der Anstieg des Noradrenalinspiegels die zentralnervöse Informationsübertragung, so dass es zu Denk- und Handlungsblockaden kommt, erkennbar an Blackout, Erstarren und großer Passivität (Petermann & Suhr-Dachs, 2013; Poole & Schmidt, 2020).
Bei den kognitiven Prozessen sind Alterseffekte feststellbar, und zwar bezogen auf die Selbstgesprächsinhalte, die häufig um das Thema Zutrauen in die eigenen Kompetenzen kreisen. Erst die älteren Kinder, etwa ab Grundschulalter, und erst recht die Jugendlichen führen bei bevorstehenden und während sozialer Situationen negative Selbstgespräche. Die Inhalte haben niedrige Erwartungen an ihre eigene Leistung zum Thema, und die Kinder und Jugendlichen bewerten ihre Kompetenzen auch schlechter, nach dem Motto: Das war doch nichts Besonderes!
2.3 Soziale Risikofaktoren
Welchen Einfluss können soziale Risikofaktoren noch haben, nachdem deutlich wurde, wie viele differenzierte biopsychische Faktoren, also in der Person liegende, wirksam sind und einen deutlichen Einfluss auf die Entwicklung einer sozialen Angststörung ausüben? Im Sinne der nächstliegenden sozialen Einflüsse sind neben Gleichaltrigen vor allem die Familie bzw. Eltern zu betrachten (Büch et al., 2015). Da auf den Einfluss von Gleichaltrigen bereits im Rahmen von Abschnitt 1.1 eingegangen wurde, sollen nachfolgend die Eltern im Blickpunkt stehen.
Elterliches Verhalten hat immer eine Vorbildwirkung und zudem einen bekräftigenden Einfluss. Da knapp jedes zweite Kind mit einer psychischen Störung einen Elternteil hat, der ebenfalls eine psychische Erkrankung aufweist, ist sowohl von genetischen als auch von sozialen Faktoren als Wirkgrößen auszugehen (Mattejat & Remschmidt, 2008).
Mütter von schüchternen, sozial unsicheren und ängstlichen Kindern beurteilen sich selbst als äußerst ängstlich, wie Melfsen et al. (2000) in ihrer Studie herausfanden. Sind oder fühlen sich Eltern belastet, so kann ihr Alltags-Stressmanagement eingeschränkt sein und sie schätzen sich eher negativ in ihrer Erziehungskompetenz ein. Dies gilt insbesondere für Mütter (Essex et al., 2010). Unter diesen Bedingungen zeigen Eltern Verhaltensweisen, die ein ungünstiges Vorbild für ein Kind bieten. Sozial ängstliche Familien haben wenig Sozialkontakte. Bedrohlich erlebte soziale Situationen werden gemieden. Damit imitieren die Kinder solches Rückzugsverhalten, sie übernehmen die negative Bewertung der Eltern gegenüber Sozialkontakten, und darüber hinaus erlernen sie keine altersangemessenen Verhaltensweisen für den Umgang mit anderen. Soziale Kompetenzen, wie Kontakt anbahnen und aufrechterhalten, sich einfühlen in andere, aber auch sich behaupten und abgrenzen können, bis hin zur Fähigkeit, soziale Herausforderungen anzunehmen, werden nicht eingeübt. Die Kinder lernen also über das Vorbild der Eltern nicht nur sozial inkompetentes Verhalten, sondern auch verzerrte Wahrnehmungen wie zum Beispiel zweideutige oder neutrale Situationen als bedrohlich einzustufen (Petermann & Petermann, 2015).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.