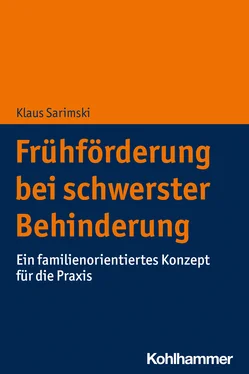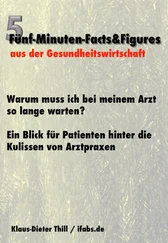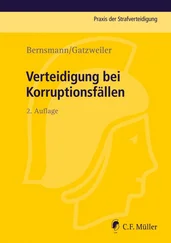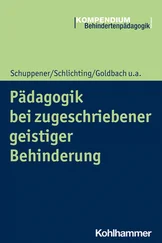Wenn man in die Literatur schaut, findet man eine Reihe von Berichten von Eltern – meistens Müttern –, die ihre Erfahrungen im Alltag mit ihrem Kind mit schwerster Behinderung schildern, ihre Sorgen und ihre Hoffnungen. Als Beispiel sei auf das Buch von Sandra Roth verwiesen, einer Journalistin, die ihre Auseinandersetzung mit der Behinderung ihrer Tochter in eindrucksvoller Weise unter dem Titel »Lotta Wundertüte. Unser Leben mit Bobbycar und Rollstuhl« beschreibt (Roth, 2013).
Andreas Fröhlich, ein von mir hochgeschätzter Kollege, hat in seinen Publikationen unter dem Titel »Basale Stimulation« über viele Jahre ein sonderpädagogisches Konzept für die Arbeit mit Menschen mit schwerster Behinderung entwickelt, das von einer wertschätzenden Haltung und einem großen Einfühlungsvermögen in ihr Erleben der Welt und ihre besonderen Bedürfnisse geprägt ist (z.B. Fröhlich, 2012, 2015; Mohr et al., 2019).
Erfahrungsberichte von Eltern und ein Verständnis für den umfassenden Unterstützungsbedarf von Menschen mit schwerster Behinderung, das sich aus solchen Quellen gewinnen lässt, sind für Fachkräfte, die mit der Frühförderung von Kindern mit schwerster Behinderung betraut sind, sehr wertvoll. Dieses Buch soll diese Grundlagen für ihre Arbeit um ein familienorientiertes Konzept ergänzen, mit dem die Lebensqualität von Kindern mit schwerster Behinderung und ihrer gesamten Familie unterstützt werden kann. Es wird somit nicht um eine Übungssammlung zur Frühförderung oder die Schilderung von Therapiekonzepten gehen, sondern um einen Leitfaden, an dem sich Fachkräfte in Frühförderstellen, Sozialpädiatrischen Zentren oder Therapiepraxen orientieren können, um den besonderen Bedürfnissen dieser Kinder, ihrer Eltern und Geschwister gerecht zu werden. Ich hoffe, dass der Band einen Beitrag leisten kann, der diesen Fachkräften in ihrer praktischen Arbeit nützlich ist.
München, im Sommer 2021
Prof. Dr. Klaus Sarimski
1 Zielgruppe, Lebensqualität, Entwicklung
In diesem Kapitel erfahren Sie, um welche Kinder es geht und wie sich ihr Unterstützungsbedarf beschreiben lässt. Darüber hinaus wird erläutert, an welchen Kriterien sich die Lebensqualität von Kindern mit schwerster Behinderung und ihren Familien ablesen lässt und wie sich die Bedeutung der Eltern-Kind-Interaktion und der familiären Alltagsaktivitäten in ein allgemeines Entwicklungsmodell einordnen lässt, das der Frühförderung von Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen zugrunde liegt.
Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit schwerster Behinderung wird in der internationalen Fachliteratur unterschiedlich definiert. Einige Autoren sehen einen komplexen und lebenslangen Unterstützungsbedarf in allen alltäglichen Lebensbereichen als zentrales Merkmal an, andere Autoren definieren sie als Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit sehr schweren intellektuellen und motorischen Behinderungen in Verbindung mit Sinnesbeeinträchtigungen. In vielen Fällen bestehen zusätzliche gesundheitliche Probleme.
Versuche der Definition mittels standardisierter Beurteilungsverfahren
In der englischsprachigen Literatur wird von Personen mit einer schwersten intellektuellen und mehrfachen Behinderung (»profound intellectual and multiple disabilities; PIMD) bzw. schwersten Lernstörungen (»profound and multiple learning disabilities; PMLD) gesprochen (Maes et al., 2021). Nakken & Vlaskamp (2007, S.85) formulieren:
«Individuals with PIMD have two key defining characteristics: (a) profound intellectual disability and (b) profound motor disability. They also have a number of additional severe or profound secondary disabilities or impairments.«
Autoren, die diese Begriffe verwenden, beziehen sich in der Regel auf die medizinischen Klassifikationssysteme ICD-10 oder DSM-V. Dort ist eine schwerste intellektuelle Behinderung definiert als solche, bei der der Intelligenzquotient unter 20–25 liegt, während er bei Menschen mit schwerer intellektueller Behinderung (»severe intellectual disabilities«, »severe global learning disabilities«) im Bereich zwischen IQ 35 und IQ 50 liegt. Um den Grad der motorischen Einschränkungen dieser Kinder zu beschreiben, verwenden die Autoren häufig das »Gross Motor Function Classification System«, das sich in der Klassifikation von Kindern mit einer Cerebralparese bewährt hat. Dabei wird der Schweregrad in fünf Stufen eingeteilt. Bei sehr schwerer und mehrfacher Behinderung liegt in der Regel ein Grad IV oder V vor, d.h. die Kinder und Jugendlichen sind nicht zu einer selbständigen Fortbewegung in der Lage.
Eine Abgrenzung des Personenkreises mittels standardisierter Testverfahren ist jedoch fragwürdig. Intelligenztests sind aufgrund der schweren Einschränkungen der motorischen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen und einer zusätzlichen Hör- oder Sehbehinderung in der Regel nicht valide durchführbar. Das bedeutet, dass ihre kognitiven Funktionen nicht eindeutig beurteilbar sind. Auch zusätzliche Sinnesbeeinträchtigungen sind nur schwer durch objektive Testverfahren zu beurteilen, da die meisten der dafür verwendeten Verfahren eine aktive Mitarbeit der Kinder und Jugendlichen und in vielen Fällen auch sprachliche Reaktionen auf Testaufgaben voraussetzen.
In der internationalen Fachdiskussion besteht Einigkeit, bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit intellektueller Behinderung nicht nur die Intelligenzleistungen, sondern auch die adaptiven Kompetenzen zu erfassen. Sie umfassen die »funktionalen« Fertigkeiten, über die ein Kind, Jugendlicher oder Erwachsener bei der Bewältigung des Alltags verfügt. Zur Beurteilung der adaptiven Kompetenzen können z.B. die »Vineland Adaptive Behavior Scales« (VABS) verwendet werden, deren dritte, aktualisierte Auflage auch in einer deutschen Fassung zur Verfügung steht (Sparrow et al., 2021).
Bei einer schwersten Behinderung liegen die kognitiven, sprachlichen und adaptiven Fähigkeiten unter dem Entwicklungsniveau einjähriger Kinder mit unbeeinträchtigter Entwicklung (z.B. Ware, 1996; Nakken & Vlaskamp, 2007). Diese Definition soll deutlich machen, dass ein ausgeprägter Hilfe- und Unterstützungsbedarf vorliegt und die Entwicklungsschritte in den sensomotorischen und vorsprachlichen kommunikativen Fähigkeiten, die ein Kind im ersten Lebensjahr vollzieht, als eine Orientierungshilfe für die Einschätzung des Unterstützungsbedarfs bei Menschen mit schwerster Behinderung gelten können.
Kompetenzen und Entwicklungsschritte bei schwerster Behinderung lassen sich auf diesem Entwicklungsniveau durch adaptive Kompetenzskalen, die für Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters entwickelt wurden, nicht ausreichend differenzieren. Daher wurden im englischsprachigen Raum für diese Zielgruppe spezifische Kompetenzinventare, z.B. von Kiernan & Jones (1982; »Behaviour Assessment Battery«), entwickelt. Eine aktualisierte Bearbeitung dieser Skalen ist in den Niederlanden in Vorbereitung. Die Skalen sind in fünf Bereiche gegliedert: emotionales und kommunikatives Verhalten, Sprachverstehen, allgemeine Kommunikation, visuelles Verhalten, exploratives Verhalten. Insgesamt umfassen sie 100 Items, die auf den komplexen Unterstützungsbedarf dieser Zielgruppe abgestimmt sind. Zur Beurteilung der konvergenten Validität überprüften Wessels et al. (2020) die korrelativen Zusammenhänge zu der Einschätzung mit herkömmlichen Skalen zur Beurteilung der kommunikativen und motorischen Fähigkeiten bei 52 Kindern (mittleres Alter: 3;1 Jahre) und 26 Erwachsenen (mittleres Alter: 34;2 Jahre) mit schwerster Behinderung (PIMD). Das Einschätzungsverfahren erwies sich als gut tauglich für diese Zielgruppe, ist allerdings (noch) nicht in einer deutschen Version zugänglich.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgten im deutschsprachigen Raum Fröhlich & Haupt (2004) mit dem »Leitfaden zur Förderdiagnostik bei schwerstbehinderten Kindern«. Auch hier ist eine aktualisierte Neuauflage in Vorbereitung (Schäfer et al., i. V.). Die Fähigkeiten, die mit den einzelnen Items erfasst werden, beziehen sich auf die Entwicklungsspanne bis zum Ende des ersten Lebensjahres bei unbeeinträchtigter Entwicklung. Sie sind in neun Bereiche gegliedert (Tab. 1) und in einem vierstufigen Modell angeordnet; die Niveaueinteilung entspricht etwa der Entwicklung in den vier Quartalen des ersten Lebensjahres:
Читать дальше