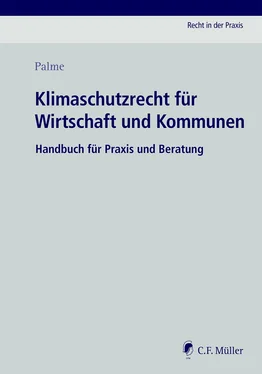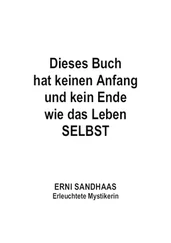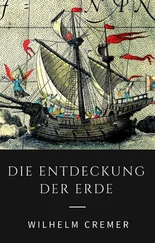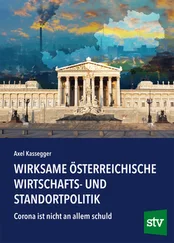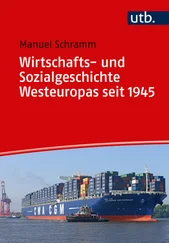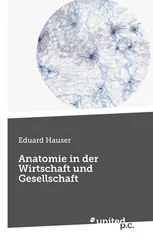B. Stahlerzeugung, Kupfererzeugung, Aluminium-, Glas- oder Zementindustrie dar. Denn Konkurrenten aus Weltregionen mit geringeren oder gar keinen klimapolitischen Ambitionen können dadurch ihre Waren deutlich günstiger anbieten. Hinzu kommt das Problem des Carbon Leakage [60]: Es besteht die Gefahr, dass die heimische Industrie in die klimapolitisch weniger ambitionierten Staaten oder Weltregionen abwandert und dort wenig bis gar nicht mit kostspieligen Auflagen zum Klimaschutz belastet wird. Im Endeffekt kann dies zu einer (Über-)kompensation von CO 2 -Einsparungen durch erhöhte Emissionen im Ausland führen und damit die unilateralen Klimaschutzmaßnahmen im eigenen Land konterkarieren.[61] Es stellt sich also die Frage, wie unilaterale Klimaschutzmaßnahmen so ausgestaltet werden können, dass weder die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie leidet noch es zu Carbon Leakage Effekten kommt.[62] Hierzu hat das Europäische Parlament im März 2021 einen Vorschlag gemacht, der eine CO 2 -Abgabe auf Importe von Ländern vorsieht, wenn diese Länder bei der Produktion dieser Güter keinen ausreichenden Klimaschutzstandards einhalten.[63]
2. Kapitel
EU-Recht
A. Primärrechtliche Grundlagen im AEUV 1 – 52 I. Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 1 Da die Europäische Union (EU) kein Staat, sondern lediglich eine supranationale Staatengemeinschaft ist, verfügt sie nur insoweit über Regelungskompetenzen als diese durch die EU-Verträge auf sie übertragen wurden. Dies gilt natürlich auch für die Klimaschutzregulierung. 2 Genauer geregelt ist dies in Art. 5 Abs. 1 und 2 EUV[1]. Nach dem in Art. 5 Abs. 2 Satz 1 EUV nieder gelegten Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass nach Art. 5 Abs. 2 Satz 2 EUV alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaaten verbleiben. 3 Zunächst ist im Zusammenhang mit dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zu prüfen, ob die EU überhaupt tätig werden kann. Danach ist für jeden verbindlichen Rechtsakt der EU nicht nur eine ausdrückliche, sondern auch die richtige Kompetenzgrundlage zu suchen. Letzteres ist deshalb von Bedeutung, weil die Wahl der Kompetenzgrundlage über Organkompetenz, Handlungsformen und Verfahren entscheidet.[2] 4 Für die ausdrücklich der EU zugewiesenen Kompetenzen lässt sich diese Prüfung noch verlässlich durchführen. Schwieriger wird es mit nicht ausdrücklich übertragenen Kompetenzen. Dabei geht es um die sogenannten implied powers .[3] Nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH sind die Vorschriften des europäischen Primär- und Sekundärrechts so auszulegen, dass sie zugleich diejenigen Vorschriften beinhalten, bei deren Fehlen sie sinnlos wären oder nicht in vernünftiger und zweckmäßiger Weise zur Anwendung gelangen könnten. Diese Figur ähnelt somit der im deutschen Verfassungsrecht bekannten Figur der Zuständigkeit kraft Sachzusammenhang .[4]
B. Sekundärrechtsakte 53 – 197 1. Allgemeines 53 Die EU hat im Rahmen ihrer Klimaschutzkompetenzen verschiedene Möglichkeiten, tätig zu werden, je nachdem welche Art von Sekundärrechtsakt sie wählt. Da die Rechtsfolgen erheblich unterschiedlich sein können, werden mögliche Arten von Sekundärrechtsakten vorab kurz dargestellt. Aufgeführt sind diese Möglichkeiten in Art. 288 AEUV , wonach für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union die Organe Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen annehmen können.
C. Nationale Alleingänge im Klimaschutzrecht 198 – 235 I. Klimaschutz als Mehrebenen-Aufgabe 198 Es wurde bereits mehrfach deutlich, dass Klimaschutz eine Mehrebenen-Aufgabe ist, die nur durch das Zusammenwirken internationaler und europäischer Anstrengungen sowie Anstrengungen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, aber auch durch Anstrengungen von Wirtschaft und Zivilgesellschaft gelingen kann. 199 Dies hat aber zur Folge, dass es auf all diesen Ebenen zu rechtlichen Regelungen kommt, die ihrerseits wiederum zu Verschränkungen der Rechtsordnungen führen. Gerade beim Verhältnis des europäischen Klimaschutzrechts zum nationalen Klimaschutzrecht wird dies besonders deutlich. Denn oft hat die Europäische Union den Anspruch, mit ihren Rechtsakten die Materie abschließend zu regeln und den Mitgliedstaaten daher nur noch begrenzte nationale Spielräume für eigene Gesetze zu belassen. Dies ergibt sich schon aus der Logik eines Binnenmarkts, der ja gerade durch einheitliche, von der Europäischen Union gesetzte Regeln definiert ist.[254] 200 Andererseits wird aber auch gerade im Klimaschutz immer wieder bemängelt, dass die Europäische Union hier nicht ambitioniert genug sei. Es stellt sich daher die Frage, welche Spielräume die deutsche Politik [255] hat , national ambitionierteren Klimaschutz über die Vorgaben des europäischen Klimaschutzrechts hinaus zu betreiben.[256] Diese Fragen haben hohe Praxisrelevanz wie die Diskussion etwa um die Einführung einer nationalen CO 2 -Steuer[257] oder auch um die europarechtliche Zulässigkeit des Brennstoffemissionshandelsgesetzes [258] zeigt.
D. Vorgaben des Europäischen Beihilferechts 236 – 246 I. Problemaufriss 236 In der Klimaschutzpolitik wird sehr viel mit Subventionen gearbeitet. So gibt es etwa die EEG-Förderung für erneuerbaren Energie, wodurch die Energiewende fortgeführt werden soll. Es gibt nach dem Kraftwärme-Kopplungsgesetz Fördermittel für den Ausbau der klimafreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung. § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung enthält reduzierte Netzentgelte, wenn bestimmte netzstabilisierende Lastprofile eingehalten werden. Teilnehmer am EU-ETS bekommen Begünstigungen, um Carbon Leakage entgegen zu wirken. Dasselbe gilt für das neue deutsche Brennstoffemissionshandelsgesetz. Stromkostenintensive Unternehmen erhalten im Rahmen der Besonderen Ausgleichsregelung eine erhebliche Reduzierung der EEG-Umlage zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit sowie zahlreiche Vergünstigungen bei der Energie- und Stromsteuer. 237 Kurzum wird in der nationalen Klimaschutzpolitik mit zahlreichen Subventionen im weitesten Sinne gearbeitet. Staatliche Beihilfen sind aber nach Art. 107 f. AEUV grundsätzlich verboten und nur im Ausnahmefall erlaubt. Wird dagegen verstoßen, droht den ehemals begünstigten Unternehmen eine Rückabwicklung weit zurück in die Vergangenheit, bei der das EU-Recht sogar Insolvenzen in Kauf nimmt.[284] Solche Vergünstigungen müssen daher mit der Wettbewerbsaufsicht der Kommission abgestimmt werden, wenn sie rechtssicher sein sollen. So standen daher auch noch einige Neuerungen durch das EEG 2021 unter beihilferechtlichem Genehmigungsvorbehalt.[285]
3. Kapitel Klimaschutzrecht für Wirtschaft und Kommunen Handbuch für Praxis und Beratung von Dr. Christoph Palme www.cfmueller.de
Bundesrecht Klimaschutzrecht für Wirtschaft und Kommunen Handbuch für Praxis und Beratung von Dr. Christoph Palme www.cfmueller.de
A. Verfassungsrecht 1 – 22 Klimaschutzrecht für Wirtschaft und Kommunen Handbuch für Praxis und Beratung von Dr. Christoph Palme www.cfmueller.de
B. Klimaschutzrecht für Wirtschaft und Kommunen Handbuch für Praxis und Beratung von Dr. Christoph Palme www.cfmueller.de
Klimaschutzpaket 2019 Klimaschutzrecht für Wirtschaft und Kommunen Handbuch für Praxis und Beratung von Dr. Christoph Palme www.cfmueller.de
23 – 61 Klimaschutzrecht für Wirtschaft und Kommunen Handbuch für Praxis und Beratung von Dr. Christoph Palme www.cfmueller.de
C. Emissionshandelsrecht 62 – 69 Klimaschutzrecht für Wirtschaft und Kommunen Handbuch für Praxis und Beratung von Dr. Christoph Palme www.cfmueller.de
Читать дальше