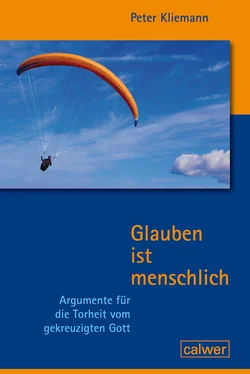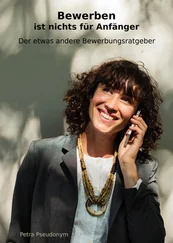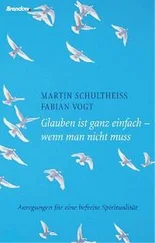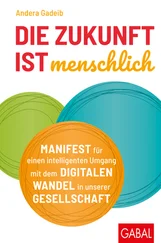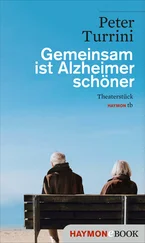Ein Missverständnis?
→ Glauben, Theologie und Naturwissenschaften
• Ein erstes Argument lautet, die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften ließen sich mit einem Gottesglauben, der ja weitgehend auf märchen- und mythenhaften Annahmen beruhe, nicht vereinbaren. Gottesglaube sei vielleicht in früheren Zeiten ein angemessener Erklärungsversuch der Wirklichkeit gewesen, zu Beginn des dritten Jahrtausends sei er jedoch endgültig überholt. – Diese These beruht weitgehend auf Missverständnissen, die im nächsten Kapitel bei einer Untersuchung des Verhältnisses von Glauben, Theologie und Naturwissenschaft ausgeräumt werden sollen.
2. Argument: Der Gottesglaube hat in seiner bisherigen Geschichte wenig Positives bewirkt.
Kirche = Gott?
• Ein zweites Argument verweist auf die Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten, die im Namen der Religion und speziell auch des Christentums bereits angerichtet wurden (Kreuzzüge, Inquisition, Hexenverbrennungen, Religionskriege, Verquickung von Mission und Kolonialismus, Verteufelung von Sexualität, Segnung von Kanonen, Bündnisse zwischen Thron und Altar, Missbrauch von Minderjährigen und Vertuschung der Skandale – um nur einiges zu nennen), und zieht daraus den Schluss, dass Gottesglauben bisher wenig Positives hervorgebracht habe. – Diese Kritik am bisherigen Verlauf der Kirchengeschichte ist sehr ernst zu nehmen (auch wenn die Geschichte des Christentums dabei oft allzu einseitig und polemisch dargestellt wird!), andererseits kann ein Versagen der Institution Kirche und ihrer Mitglieder aber niemals die Möglichkeit der Existenz Gottes widerlegen. Was die kritische Analyse der Kirchengeschichte belegt, ist doch nur, dass die Institution Kirche und ihre Mitglieder sehr oft das Evangelium von Jesus Christus, auf das sie sich beriefen, entstellt, in sein Gegenteil verkehrt und missbraucht haben. Daraus kann man die Notwendigkeit einer radikalen Kirchenkritik ableiten, die – ähnlich wie bei der notwendigen Kritik an Institutionen wie Schule, Staat oder Familie – aber nicht unbedingt die völlige Abschaffung von Kirche und Christentum beinhalten muss, sondern eben genauso auch ihre Reform und Erneuerung zum Ziel haben könnte.
3. Argument: Wie kann Gott das zulassen?
• Ein drittes, gewichtiges Argument entsteht aus dem Protest gegen die Fülle menschlichen Leidens, das wir sowohl in unserer näheren Umgebung als auch weltweit beobachten können. Behinderte Menschen und verhungernde Kinder, Naturkatastrophen, unverschuldete Krankheiten, soziale Ungerechtigkeiten, Kriege, Folter oder gar unvorstellbare Gräuel wie die von Auschwitz führen zu der Frage, die man in der Sprache der Theologen als Theodizeefrage (Theodizee, von griech. theós = »Gott« und díkē = »Gerechtigkeit«, wörtlich: »Rechtfertigung Gottes«) bezeichnet und die im Alltag meist in der Formulierung »Wie kann Gott das zulassen?« ihren Ausdruck findet. Diese Frage, die Georg Büchner in seinem Drama »Dantons Tod« den »Fels des Atheismus« genannt hat, 10stellt für den Gottesglauben einen nicht zu unterschätzenden Prüfstein dar.
Keine vorschnellen Antworten!
»Die Frage ›Wo war Gott in Auschwitz?‹, an der sich die verschiedensten Denker versucht haben, geht nach meiner Ansicht über menschliche Kräfte. Es mag der Mühe wert gewesen sein, die klügsten, tiefsten, persönlichsten Antworten auf diese Frage zu versuchen. Ich fühle mich dieser Frage nicht gewachsen. Es bleibt uns nur auf Auschwitz zu antworten. Und eine solche Anwort kann – so möchte ich sagen – letztlich nicht gedacht, sondern nur getan werden.« Yehoshua Amir 11
Vorschnelle Antworten wie die, dass Gott die Menschen vielleicht nur auf die Probe stellen wolle oder dass die Leiden der Menschen vielleicht die Buße für begangene Untaten und Verfehlungen seien, sind aus zwei Gründen unangebracht:
– Zum einen maßen sie sich an, Gottes Pläne und Absichten zu kennen, seinen Willen berechnen zu können, was zumindest dem biblischen Gottesbild widerspricht und schon den Freunden Hiobs Tadel eingebracht hat (vgl. Hiob 42,7ff.).
– Zum anderen nützen Theorien über die Ursachen des Leids dem, der leidet, sehr wenig. Sie laufen Gefahr, zynisch und herzlos zu sein.
Sinnvoller ist es hingegen, sich zu überlegen, wie man mit dem Leid, das ja auch nach der Abschaffung des Gottesglaubens nicht aus der Welt geschafft wäre, umgehen könnte, die Frage »Wie kann Gott das zulassen?« also in die Frage »Wie kann ich mit dem Leid auf eine produktive und würdige Art und Weise umgehen?« umzuformulieren. Ob es der biblische Gottesglauben wirklich ermöglicht, mit Leiden produktiver und würdiger umzugehen als z.B. der Atheismus, kann jeder Mensch nur für sich selbst prüfen. Leiden ist jedenfalls sowohl im Alten Testament (vgl. neben dem Buch Hiob die Auseinandersetzung mit dem Leid in den Klagepsalmen!) als auch für die neutestamentliche Botschaft vom unschuldig am Kreuz hingerichteten Gottessohn nicht nur ein beliebiges Thema unter vielen. 12
»Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Ps 22,2; Mk 15,34
Kann man die Existenz Gottes beweisen?
Wer sich über die Existenz oder Nicht-Existenz eines göttlichen Wesens Gedanken macht, kommt sehr schnell zu der Frage, ob man die Existenz Gottes denn beweisen könne. 13In der Geschichte der christlichen Theologie, vor allem auch in der Scholastik des Mittelalters, wurden in diesem Zusammenhang sogenannte » Gottesbeweise « formuliert:
Fünf »Gottesbeweise«
• Der kosmologische Gottesbeweis (von griech. kósmos = »Schmuck, Ordnung, Weltall«) schließt aus der Tatsache, dass es in der Welt Bewegung gibt und dass jedes Bewegte seinerseits von einem Anderen bewegt wird, auf die Notwendigkeit eines ersten Bewegers – »quod omnes dicunt Deum« (»und eben dies nennen alle ›Gott‹«, so die berühmte Standardformel des Thomas von Aquin, 1225–1274, am Ende seiner Beweisgänge). Eine Variante des kosmologischen Gottesbeweises geht davon aus, dass alles in der Welt eine Ursache hat, es eine endlose Kette von Ursachen aber nicht geben könne. Also müsse es eine erste Ursache geben – quod omnes dicunt Deum.
»HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.« Ps 104,24
• Der teleologische Gottesbeweis (von griech. télos = »Ziel, Endzweck«) geht von der Ordnung, Zweckmäßigkeit und Zielstrebigkeit der Welt und vor allem auch der Natur aus. Aus dem Staunen über die kleinen und großen »Wunder der Natur« schließt dieser Gottesbeweis auf die Notwendigkeit eines Weltordners oder Weltschöpfers.
• Der ethnologische Gottesbeweis (von griech. éthnos = »Volk«) schließt aus der Beobachtung, dass alle Völker und Kulturen – weitgehend unabhängig voneinander – Vorstellungen von göttlichen Wesen entwickelt haben, dass dann an dieser Vorstellung doch etwas dran sein müsse.
• Der ontologische Gottesbeweis (von griech. on = »seiend«, »seinsmäßig«, »dem Sein nach«) geht auf den mittelalterlichen Theologen Anselm von Canterbury (1033–1109) zurück. Anselm definiert Gott als »etwas, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann.« Wäre dieser »Gott« nur ein Produkt meiner Gedankenwelt, dann könnte ich mir jedoch noch etwas Größeres denken. Wer »Gott« also so wie Anselm definiert, kann gar nicht anders, als auch seine Existenz mitzudenken.
• Der moralische Gottesbeweis schließlich, der mit dem Philosophen Immanuel Kant (1724–1804) in Verbindung gebracht wird, lautet: Gäbe es keinen Gott, dann gäbe es für uns Menschen letztlich auch keinen notwendigen Grund, uns moralisch und sittlich zu verhalten.
Читать дальше