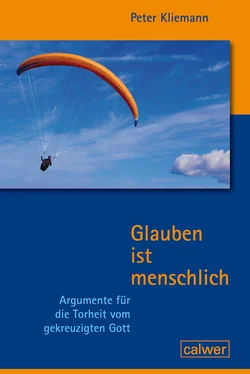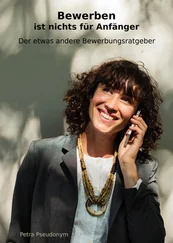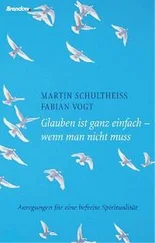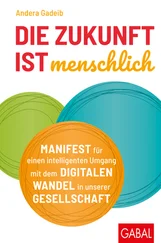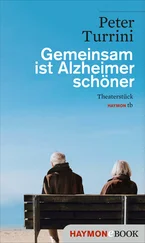Immerhin kann man aus sozialwissenschaftlichen Untersuchungen z.B. lernen,
– dass es für menschliches Leben wichtig ist, dass die Kommunikation mit anderen Menschen gelingt (was natürlich genauer zu definieren wäre!);
– dass es für menschliches Leben wichtig ist, dass der Mensch sich realisierbare Aufgaben stellt, dass er sich für etwas engagiert;
– dass es für menschliches Leben wichtig ist, dass der Mensch sich mit der Endlichkeit seines Lebens, mit seinen Schwächen, mit dem Tod und der Möglichkeit von Schicksalsschlägen auseinandersetzt;
– dass die Erfahrung von Sinn nicht durch bloße Reflexion herstellbar ist, sondern vor allem auch durch emotionale und unbewusste Faktoren mitbestimmt wird;
– dass das, was der eine als sinnvolles Leben empfindet, für den anderen noch lange nicht sinnvoll sein muss;
– dass einem Menschen, der am Sinn des Lebens zweifelt, menschliche Zuwendung mehr nützt als alle Theorien über den Sinn des Lebens.
■ Weil der Mensch – heute mehr denn je – den Sinn seines Lebens erst suchen muss, kann kein einzelner Mensch oder keine Menschengruppe sich anmaßen, den Sinn des Lebens für alle Menschen in allen Situationen zu kennen. Jeder kann nur artikulieren und versuchen, anderen plausibel zu machen, worin er aufgrund seiner Erfahrungen und seines Wissens den Sinn des Lebens sieht. Wer sich damit nicht zufrieden geben und Eindeutigkeit um jeden Preis erzielen will, läuft Gefahr, anderen Menschen physisch oder psychisch Gewalt anzutun, ihre Andersartigkeit und Vielfalt zu unterdrücken und diktatorischen oder inquisitorischen Verhältnissen den Weg zu bereiten.
Ist bei der Behandlung der Sinnfrage also grundsätzlich Toleranz und Offenheit für die Lebensäußerungen anderer Menschen angezeigt, so darf diese Haltung jedoch nicht mit Beliebigkeit und Gleichgültigkeit verwechselt werden. Weil meine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens in ihren Auswirkungen meine Mitmenschen konkret berührt und weil ihre Antworten auch auf mich unter Umständen unangenehme Folgen haben, können wir uns nicht damit zufrieden geben, dass eben jeder sein Leben so leben soll, wie er gerade Lust hat. Müsste insbesondere in unserer heutigen Welt, die in ihrer Gesamtheit von ökologischen, militärischen, ernährungspolitischen und medizinischen Katastrophen unvorstellbaren Ausmaßes bedroht ist, nicht jeder Mensch bestrebt sein, seine vorläufige Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens mit den Antwortversuchen anderer Menschen zu konfrontieren und mit ihnen gemeinsam um den richtigen Weg zu einem lebenswerteren Leben zu streiten?
Die folgenden Bemühungen, die Sinnfrage aus christlicher Sicht zu beantworten, verstehen sich als ein Beitrag zu solch einem Dialog.
Gott = Liebe?
■ Sollte ich in einem Satz zusammenfassen, worin für mich als Christ der Sinn des Lebens liegt, so würde ich in Anlehnung an den 1. Johannesbrief sagen: In der Liebe. In der Liebe, die Gott uns schenkt und die wir Menschen weitergeben sollen. Solch eine Behauptung ist natürlich erklärungsbedürftig, denn es gibt nicht viele Wörter in der deutschen Sprache, die vieldeutiger und missverständlicher sind als die Begriffe »Gott« und »Liebe«. Man könnte die folgenden Arbeitsthesen deshalb als eine ausführliche, in vielerlei Variationen durchbuchstabierte Paraphrase des neutestamentlichen Satzes »Gott ist Liebe« (1. Joh 4,8.16) ansehen. 9
■ Wer die These »Gott ist Liebe« aufstellt, muss sich am Anfang des 21. Jahrhunderts zunächst einmal bewusstmachen, dass viele Zeitgenossen die Existenz Gottes überhaupt bestreiten oder doch zumindest anzweifeln. Im nächsten Kapitel wird es deshalb darum gehen, zu erklären, was eigentlich für oder gegen die Existenz eines göttlichen Wesens spricht.
Kapitel II
Gott? Gibt es den überhaupt?
Der neuzeitliche Atheismus als Herausforderung für den christlichen Glauben
»Lasst uns essen und trinken; denn morgen sind wir tot!«
Zur Geschichte des Begriffs »Atheismus«
Der Begriff »Atheismus« (von griech. átheos = »ohne Gott«, »gottleugnend«) hat eine lange Geschichte. Als »Atheisten« wurden in der griechisch sprechenden Antike z.B. diejenigen bezeichnet, die sich weigerten, die offiziellen Gottheiten des Staatskultes anzubeten; das heißt, auch die ersten Christen waren nach dieser Definition »Atheisten«. Atheismus im heutigen Sinn, d.h. als grundsätzliche Leugnung der Existenz eines göttlichen Wesens, ist jedoch ein relativ neues Phänomen. Es wurde schon immer, zum Teil auch mit Waffengewalt, darum gestritten, wie Gott beschaffen sei und was genau sein Wille sei; dass es aber vielleicht gar keinen Gott gibt, das ist ein Gedanke, der im Zeitalter der europäischen Aufklärung, also dem 17./18. Jahrhundert, Boden gewinnt und erst im 19. und 20. Jahrhundert auch breitere Bevölkerungsschichten erfasst.
Der Atheismus der Bundesbürger neigt zur Sprachlosigkeit.
Liest man neuere religionssoziologische Untersuchungen zum religiösen Bewusstsein der Bundesbürger, dann gewinnt man den Eindruck, dass wir es zur Zeit vor allem mit einem schleichenden, versteckten Siegeszug des Atheismus zu tun haben. Wer sich ausdrücklich zum Atheismus bekennt, riskiert, seine Position, seine Lebensperspektiven und Werte, das, »woran er sein Herz hängt«, erläutern und begründen zu müssen. Er ist insofern für Christen ein sehr interessanter und anregender Gesprächspartner. Viel häufiger als dieser Überzeugungsatheismus ist heute jedoch ein stillschweigender, sprachloser Atheismus, für den die Gottesfrage anscheinend überhaupt kein Thema mehr ist, der sich nicht einmal mehr die Mühe macht, Gott auch nur abzulehnen.
Die versteckte Gottesfrage
Wohlstandsatheismus?
»Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist […] Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest.« Gal 6,1
Will man die Lebensfragen, die über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg in religiösen Kategorien formuliert wurden, nicht mit einem Schlag für gänzlich erledigt und beantwortet betrachten, dann wäre zu überlegen, ob sie heute in einem anderen Rahmen artikuliert werden (in der Politik? in Talkshows? in therapeutischen Gruppen? in der Popmusik? in der Kulturszene? in den sozialen Medien?) oder ob sie nicht nur aus Hilflosigkeit und Bequemlichkeit verdrängt und beiseitegeschoben werden. Im letzteren Fall hätten wir es mit einem unkritischen und unreflektierten Materialismus zu tun, getreu dem schon in der Bibel zitierten, in einer Wohlstandsgesellschaft ganz neuen Ausmaßes aber hochaktuellen Motto »Lasst uns essen und trinken; denn morgen sind wir tot!« (1. Kor 15,32; Jes 22,13). Sollte dem so sein, dann wäre dies, zumindest für Christen, allerdings kein Grund, unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ihre Flucht vor Fragen, die ihnen zu komplex und schwierig erscheinen, lediglich zum Vorwurf zu machen, sondern vor allem auch ein Anlass, sie zur Artikulation und Reflexion ihrer vergessenen und verdrängten Lebensfragen zu ermutigen und mit ihnen gemeinsam nach lohnenden Lebenszielen zu suchen, die ein Überschreiten von bloßen Konsumentenrollen möglich machen.
Drei Argumente gegen Gott
Da, wo Atheismus sich artikuliert, erreicht er nur selten das philosophische Niveau von Feuerbach, Marx oder Nietzsche, auf die gleich noch einzugehen sein wird. Auch wer die Gedankengänge dieser Philosophen nicht kennt, kann in der Regel drei Gründe anführen, die nach weit verbreiteter Ansicht den Glauben an Gott unmöglich machen:
1. Argument: Naturwissenschaft und Gottesglaube sind unvereinbar.
Читать дальше