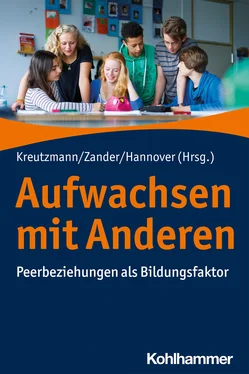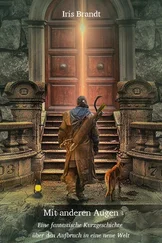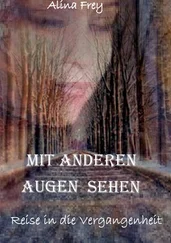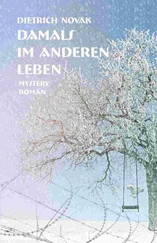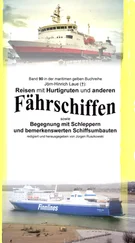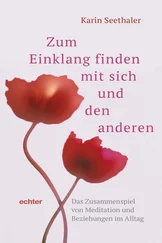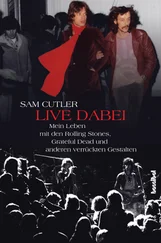Für ihre wertvollen Hinweise und die sorgfältige Korrekturarbeit bei der Zusammenstellung dieses Buches möchten wir uns – auch im Namen der Autorinnen und Autoren – ganz herzlich bei unserer Mitarbeiterin Nina Mulaimović bedanken.
Im März 2021
Madeleine Kreutzmann, Lysann Zander, Bettina Hannover
I Theoretische und methodische Grundlagen der Peerforschung aus pädagogischer und bildungs- wissenschaftlicher Perspektive
1 Peerbeziehungen: Sozialökologische und entwicklungspsychologische Aspekte
Peter F. Titzmann & Philipp Jugert
Zusammenfassung
• Die Komplexität von Peerbeziehungen drückt sich in dyadischen Freundschaften sowie in Cliquen, Crowds und der Jugendkultur aus.
• Unterschiedliche Prozesse führen zu Ähnlichkeiten in Peerbeziehungen. Man spricht auch vom sogenannten Ähnlichkeitsprinzip in Freundschaften.
• Im Jugendalter sind Freundschaften von vielfältigen biologischen, kognitiven und sozialen Veränderungen gekennzeichnet.
• Aus dem Wissen über das Ähnlichkeitsprinzip von Freundschaften sowie über die biologischen, kognitiven und sozialen Veränderungen können Interventionsmöglichkeiten für Bildungseinrichtungen abgeleitet werden, die es ermöglichen, eine entwicklungsförderliche Umgebung für die Jugendlichen zu gestalten.
Im Jugendalter gewinnen Peerbeziehungen für die Entwicklung des Einzelnen zunehmend an Bedeutung, während gleichzeitig die Abhängigkeit von den Eltern abnimmt (Brown & Klute, 2008; Steinberg & Silverberg, 1986). Positive Peerbeziehungen wie gegenseitige Freundschaften erfüllen dabei vielfältige Funktionen: Sie vermitteln Jugendlichen ein Gefühl der Akzeptanz und Zugehörigkeit; helfen ihnen, soziale Kompetenzen zu entwickeln; unterstützen sie bei ihren ersten Schritten in Richtung romantischer Beziehungen und können die Wahrnehmung und Regulierung von Emotionen positiv beeinflussen (Adams & Berzonsky, 2003; Hartup, 1996). Ihre Bedeutung zeigt sich auch in der Tatsache, dass Freundschaften im Jugendalter zum Selbstwertgefühl und zum Erleben sozio-emotionaler Unterstützung beitragen (Hartup, 1996) sowie die langfristige Anpassung in anderen Entwicklungsbereichen – wie dem Arbeits- oder Partnerschaftsumfeld – erleichtern (Roisman, Masten, Coatsworth & Tellegen, 2004). Angesichts dieser vielfältigen positiven Funktionen von Peerbeziehungen wird der Aufbau reifer wechselseitiger Freundschaften als wichtige Entwicklungsaufgabe für das Jugendalter betrachtet, wenn auch erste und prägende Freundschaftserfahrungen bereits in den Vorschuljahren gemacht werden und wichtig sind (Havighurst, 1972).
Aufgrund der Bedeutung von Peers hat sich die psychologische Forschung bereits seit geraumer Zeit mit dieser Form sozialer Beziehungen beschäftigt. In diesem Kapitel möchten wir vor allem drei universelle Aspekte der Peerbeziehungen näher beleuchten:
(a) die Ökologie von Peerbeziehungen;
(b) die Ähnlichkeit als allgemeines Prinzip bei der Bildung und Aufrechterhaltung von Freundschaften und
(c) die sich im Laufe der ersten Lebensjahrzehnte entwickelnden Veränderungen in Freundschaften.
1.1 Ökologische Aspekte von Peerbeziehungen
Peerbeziehungen sind stets in eine komplexe Ökologie eingebettet. Basierend auf Arbeiten von Bronfenbrenner (1995) entwickelte Brown (1999) ein Modell, das die Peer-Ökologie der sozialen Beziehungen von Jugendlichen darstellt. Es differenziert zwischen dyadischen Beziehungen (beste Freundinnen und Freunde, romantische Beziehungen), Cliquen kleiner Freundschaftsgruppen, größeren Gruppen von Gleichaltrigen (Crowds) sowie einer übergeordneten Jugendkultur.
Obwohl diese Peer-Strukturen miteinander zusammenhängen, hat jede von ihnen eine spezifische Funktion bei der Entwicklung der bzw. des Jugendlichen (Brown, 1999). Die Funktion der dyadischen Beziehungen ist es, gegenseitiges Vertrauen zu entwickeln und zwischenmenschliche soziale Fähigkeiten zu trainieren. Cliquen (kleine Freundschaftsgruppen, die aus etwa drei bis zehn Jugendlichen bestehen und sich regelmäßig treffen und sehen) bilden dagegen die Basis für gemeinsame Aktivitäten und das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Der Unterschied zwischen besten Freundinnen bzw. Freunden und Cliquen wurde beispielsweise im Zusammenhang einer Studie zu Substanzkonsum deutlich: Urberg, Degirmencioglu und Pilgrim (1997) fanden, dass beste Freundinnen und Freunde (dyadische Beziehung) vor allem für die Initiation von Zigarettenkonsum wichtig waren, während die Clique dazu animierte, Zigaretten regelmäßig zu konsumieren. Diese Ergebnisse zeigen – unabhängig vom untersuchten Verhalten –, dass unterschiedliche Peer-Strukturen spezifische Verhaltensmotivationen mit sich bringen. Ähnlich zeigte Hussong (2002), dass zwar beste Freundinnen und Freunde den größten Einfluss auf Substanzkonsum (Alkohol und Marihuana) von Jugendlichen ausüben, dass aber Cliquen und Peergruppen diesen Einfluss moderieren. So können Cliquen sowohl einen verstärkenden als auch einen reduzierenden Einfluss auf den Substanzkonsum von Jugendlichen haben, je nachdem, ob sie mehr oder weniger Substanzen konsumieren als der beste Freund oder die beste Freundin.
Crowds sind abstrakte größere Gruppen, an die sich Einzelpersonen gebunden fühlen, deren Mitglieder sie aber nicht sämtlich persönlich kennen müssen (Brown & Klute, 2008). Crowds können beispielsweise die Fans eines bestimmten Sportvereins, Menschen aus einer bestimmten geographischen Region, eines bestimmten Stadtteils oder auch Angehörige einer bestimmten ethnischen Gruppe sein. Sie sind daher nicht durch konkrete Individuen definiert, sondern beruhen auf formellen (Nachbarschaft, ethnische Gruppe) oder informellen (Interessen, Überzeugungen) Gruppenzugehörigkeiten (Brown, 1999) 1 1 Eine alternative Definition des Crowd-Begriffs stammt von Dunphy (1963), der unter Crowds das erweiterte Peernetzwerk von etwa 20 Personen versteht.
. Für Jugendliche liefern die Crowds vor allem Vorbilder für die Entwicklung von Verhalten und Identität. Identifizieren sich Jugendliche mit einer bestimmten Crowd, versuchen sie, ihr eigenes Verhalten an die Normen der jeweiligen Crowd anzupassen. So ist es unwahrscheinlich, dass der Fan eines bestimmten Sportklubs trotz eines brillanten Spielzugs der Gegnerin oder des Gegners diesem überschwänglichen Beifall spendet, oder dass ein Mitglied einer Jugendgang gegen deren wahrgenommenen Verhaltenskodex verstößt, in dem er oder sie Geheimnisse der Jugendgang an Mitglieder einer verfeindeten Gruppe weitergibt. Jugendliche können sich mehreren Crowds zugehörig fühlen, wobei die wahrgenommene Zugehörigkeit je nach Situation variieren kann. Im Stadion wird die Zugehörigkeit zum Sportverein wahrscheinlich deutlicher erlebt als die Zugehörigkeit zur Nachbarschaftscrowd, beim Stadteilfest ist es wahrscheinlich umgekehrt.
Die Jugendkultur, die vierte Peer-Struktur, ist der abstrakteste Teil der Peer-Ökologie von Brown (1999) und weist einige Parallelen zu Bronfenbrenners (1995) Makrokontext auf, der sich auf Kultur und Gesellschaft bezieht. Die Jugendkultur beeinflusst alle Kinder und Jugendlichen zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt und in einer bestimmten Kultur oder Region in ähnlicher Weise. Am besten ist ihr Einfluss zu erkennen, wenn man den allgemeinen jugendlichen Lebensstil zu verschiedenen historischen Epochen vergleicht. So war die 68er Generation in West-Deutschland durch eine Auseinandersetzung mit der Rolle der eigenen Eltern in der NS-Zeit und dem Engagement für gesellschaftliche Freiheiten geprägt. Heutzutage findet die Jugendkultur ihren Ausdruck vor allem durch die Anmahnung eines verantwortungsvolleren Umgangs mit natürlichen Ressourcen im Kontext des Klimawandels (Albert et al., 2019).
Читать дальше