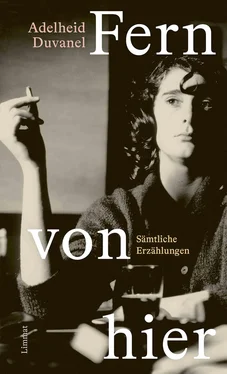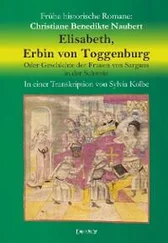An einem Nachmittag erlosch der See und alles verschwamm, als blicke man durch beschlagene Brillengläser. In den Zimmern des Hauses schienen sich große, dunkle Fächer zu öffnen, die mit rätselhaften Bildern bemalt waren.
Plötzlich trat der Großvater ins Zimmer; in der Hand hielt er einen Brief. Er blickte uns nicht an und murmelte; als die Großmutter fragte, was er denn da sage, wiederholte er den Satz und ich verstand, dass Mutter gestorben war. Ich sah, dass die Augen der Großmutter sonderbar flockig wurden; ihr Mund war wie aus dickem, dunklem Leder im weißen Gesicht. Ich begann zu zittern und mein Herz schmerzte. Wie im Traum ging ich ans Fenster. Es regnete; die Blumen sanken zu Boden, die Kamine der Häuser lösten sich auf und rutschten über die Dächer. Ich würde nie mehr nach Hause zurückkehren, Mutter von der «Party» erzählen und spüren, dass sie um meine Angst wusste.
Ein Vogel sitzt auf dem Kamin des gegenüberliegenden Hauses; der Blick in die Glasveranda ist durch einen roten Vorhang verwehrt und hinter dem Dach ragt von einer Baustelle ein Kran in den Himmel. Ich betrachte das Haus jeden Morgen und freue mich. Sonst habe ich nicht viel Grund, mich zu freuen; wenn ich mich in die Zeitung vertiefen will, lese ich statt «Tito möchte entlastet werden» – «Tito möchte entlaust werden» und statt «Bedachungen» – «Beobachtungen» – ich fürchte, nie mehr wird es mir gelingen, mich zu vertiefen, weder in die Zeitung noch in sonst etwas; ich lebe immer mehr ganz außen, und nichts mehr ist verständlich. Auch weiß ich, dass ich ein «Muffel» bin; in einer deutschen Zeitschrift, die Ingrid abonniert hat (ihre ganze Weisheit schöpft sie daraus und aus Frauenzeitschriften; jede Woche verkündete sie mir mein Horoskop, und einmal wusste sie zu berichten, das dritte Ehejahr sei ein Krisenjahr; wie recht solche Zeitschriften doch immer haben!), wurde ich mit «Sexmuffel» und «Krawattenmuffel» beschimpft, und außerdem bin ich ein Sport- und Nachmittagsmuffel; ich liebe nur den Morgen: die hellen, leichten Morgen, die beinah davonfliegen und viel versprechen.
Ich bin seit drei Wochen von Ingrid geschieden; «Ingrid und lsidor» hießen wir, als wären wir ein Mensch; heute verstehe ich nicht mehr, dass ich neben dieser seelenlosen, feigen Hündin mit dem Schlangenkopf leben konnte. Als ich sie zum ersten Mal mit dem Säugling im Arm sah, als dessen Vater ich galt, erschrak ich zutiefst; war sie dem Kind ausgeliefert oder das Kind ihr? Der Junge schielte und klemmte seine Zunge zwischen die feuchten Lippen; ich wandte mich ab, verließ bald das Spitalzimmer und sprang auf die erstbeste Straßenbahn; als sie anfuhr, trippelte ich schnell zu einem leeren Sitz und ließ mich fallen. (Obwohl ich noch jung bin, bin ich ziemlich dick und erwecke den Eindruck zu trippeln, auch wenn ich mich bemühe, elastisch zu schreiten.) Zuerst war es, als ob meine Gedanken um mich herumzufließen begännen, doch bald umkreiste ich die Gedanken, zog immer größere Kreise, geriet immer weiter weg und konnte nicht mehr zurückfinden.
Kaum war Ingrid mit dem Jungen zu Hause (der nicht mein Kind sein kann; während sie im Spital war, machte man mir Andeutungen, telefonierte mir anonym und im Briefkasten steckte ein Zettel mit einem gehörnten Ungeheuer), zog ich in ein Zimmer, das ich mir reserviert hatte; seither wohne ich hier. Die Möblierung ist karg, ja traurig; das liebe ich. Vor Gericht sagte man mir, ich hätte Ingrid böswillig verlassen und sei nun schuldig geschieden. Obwohl ich mir einrede, das beeindrucke mich gar nicht, stört es mich ein wenig, dass mich Herren, die ich nicht kenne und die mich nicht kennen, «schuldig» nennen. Sie haben mir sogar eine Strafe aufgebrummt, wie dies einst mein Vater oder die Lehrer taten; ich bin erstaunt; ich dachte, ich sei nun erwachsen und niemand mehr könne mich strafen oder mir etwas vorschreiben. Ich darf ein Jahr lang nicht heiraten; als ob ich den Wunsch geäußert hätte, heiraten zu wollen! Und ich muss Ingrid für den Jungen Geld schicken; ich verstehe nicht weshalb, denn ich liebe dieses Kind nicht.
Ich bin Cellist im Theaterorchester und kann nun üben, ohne dass Ingrid mich wegen des Jungen anschreit; ich kann ausgehen und nach Hause kommen, wann es mir passt, und rauchen, so oft und so viel ich will.
Seit gestern habe ich ein Telefon; ich konnte es kaum erwarten, doch nun weiß ich nicht, wen ich anrufen soll. Die Freunde von «Ingrid und Isidor» stehen auf Ingrids Seite; meine Berufskollegen scheinen sich nicht sonderlich viel aus mir zu machen und ich mir nicht aus ihnen; ins Wirtshaus gehe ich recht selten und Nachbarn kenne ich keine mit Namen. Da sitze ich also neben dem Telefon und starre hinaus; die Häuser sind bleich heute und die Fenster dunkel; der Nachmittag schlägt alles tot, was ich liebe. Aber wenn der Morgen kommt wie ein stolzer, silberner Prinz, schlagen die Häuser ihre Augen auf, und ich halte den Atem an und lächle, dann grüße ich demütig, denn nicht ich bin es, der sie ins Leben zurückrief. Manchmal erscheint jemand an einem der Fenster und glotzt wie ein Fisch, dann gehe ich schnell zum Tisch, decke ihn geschäftig, wärme Milch oder Suppe und warte vor Freude zitternd, ohne zu wissen, auf was oder wen.
Jetzt wird es Abend; bald wird die Nacht die Häuser begraben, auch meines; ich werde mich aufs Bett legen und nicht einschlafen können unter dem schweren Hügel. Ich muss nicht arbeiten heute und mag nichts tun. Ob ich Ingrid anrufen soll? Ich werde meinen Namen nicht nennen und auf ihren Atem lauschen; vielleicht erkennt sie den meinen? Vielleicht sieht sie wie in einem Traum die Stille um mich und die Angst; vielleicht flüstert sie meinen Namen oder schreit ihn in plötzlicher Wut?
Ich hebe den Hörer ab und stelle die Nummer ein; mein Knie schlägt gegen den Tisch; ich bebe am ganzen Körper. Ingrid sagt zweimal «Hallo» in mein Ohr. Ob sie nicht hört, wie mein Herz davonrennt? Im Hintergrund fragt eine Männerstimme ungeduldig, wer ich sei, da hänge ich wieder auf und lasse meine Hand auf den Tisch fallen und dann den Kopf; die Brille klemmt mein Nasenbein. So sitze ich lange in der Finsternis, ganz tief in mir drinnen; niemand könnte mich sehen, auch Ingrid nicht, wenn sie hereinträte. Ich habe mich zugeschlossen und bleibe bei mir; endlich bin ich in der Tiefe angelangt. Ich werde nicht mehr auf die hellen, leichten Morgen hoffen und ihnen nicht mehr glauben.
Ich weiß nicht, ob es leidenschaftliche oder zu wenig leidenschaftliche Naturen sind, die nie eine Sonnenbrille, beim Nähen keinen Fingerhut und zum Geschirrwaschen keine Gummihandschuhe tragen; was andere Menschen nötig finden, um Augen, Fingerspitzen oder Hände zu schonen, war Agnes ärgerlich, muss sie als eine lästige Wand zwischen der Wirklichkeit, zwischen dem Leben und ihrem Ich, dem Erfühlen dieses Lebens empfunden haben. Sie war meine Patin; ich war nach ihr getauft worden und verbrachte, nachdem man mich von meiner liederlichen Mutter weggenommen hatte, deren uneheliches Kind ich war, ein halbes Jahr bei ihr; nachdem sie aber schwer erkrankt war, wurde ich in ein erstes, zweites und drittes Heim gesteckt. In jedem fühlte ich mich wie eines von fünfzig oder hundert Schaumkrönchen, die von den Leiterinnen umher- oder weggeblasen werden konnten. Dass es Wellen gab und Tiefe, ahnte ich, und dass es Schiffe gab, die stampfend und Aufruhr bringend über einen hinwegfahren konnten, wusste ich, seit mein Onkel Raymond nach Tante Agnes’ Tod mich aus dem Heim holte; ich war nun dreizehn Jahre alt. Riesengroß stand er vor mir, überragte er mich bei Tisch, wo er laut vorbetete, warf er Schatten, als ob er Läden hinter sich geschlossen hätte, um das Sonnenlicht für immer von mir fernzuhalten. Hinter den Läden klopften die vielen Bäume wie Stiefel ums Haus. Ich hatte keine Freundinnen, auch keine Puppe; ganz allein war ich von Heim zu Heim gewandert, unansehnlich wie ein Gepäckstück in meinen fremden, abgetragenen Kleidern, und dass Onkel Raymond – der Mann meiner verstorbenen Tante Agnes, dieser wortkargen, kränklichen Frau, die aber mit den Augen gewärmt und deren Stimme wie ein Feuerchen geknistert hatte – mich zu sich sperrte, wurde mir von der Leiterin des letzten Heims als Glücksfall geschildert. Ich galt als bockiges, unzugängliches, verträumtes und faules Kind. Es war das erste Mal, dass sie zu mir allein redete, dass ich mich nicht als ein Teilchen einer Kindergruppe fühlte, nicht als eine in der Fabrik verfertigte Puppe, die ebenso langweilig wie alle andern aussah, die wartete und wie im Traum Befehle hörte, die allen galten: Hände waschen, Zähne putzen, Schulaufgaben lösen, beten, zu Bett gehen. Nein, nun war ich ein Einzelstück, sozusagen eine selbstverfertigte Puppe aus einer Boutique; ich erinnere mich, dass ich mir mit einem Brennen im Herzen wünschte, die Leiterin möge beachten, dass das eine meiner Augen heller war als das andere und dass meine Mundwinkel, obwohl ich ein langgezogenes, trauriges Gesicht hatte, sich leicht nach oben bogen. Ich stellte mir auch vor, sie würde mir etwas erzählen oder erklären, was ich schon lange gerne gewusst hätte: Weshalb es Wellen gab und wie es in der grauen Tiefe aussah, von der man glauben konnte, sie sei gestorben, so still schien sie, und ob ich mich als Teil dieser Tiefe betrachten durfte oder ob ich nur aus Schaum mit ein bisschen spitzem Licht bestand; ja, das Licht war spitz und tat weh, aber die Dunkelheit, in der Onkel Raymond mich verstecken wollte, erhoffte ich mir rund und weich.
Читать дальше