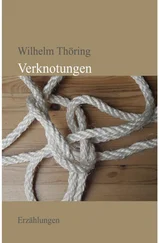Nach und nach stellte der Trauerzug sich zusammen und setzte sich in Bewegung, ohne Glockengeläute, ohne Gesang und ohne Priester. Dafür flatterte eine rote Fahne voran. Der Sarg folgte, von vier Männern getragen. Er war mit bäuerlichen Blumen und einfachen Kränzen bedeckt. Obenauf lag ein breiter, schöner Kranz. Die Sciori hatten ihn aus der Stadt bestellt. Er wurde sehr bewundert. Hinter dem Sarg gingen die nächsten Verwandten, dann die besten Freunde des Verstorbenen; nachher die Reichen des Dorfes, die weniger Reichen, die Armen und die ganz Armen und zum Schluss, wie es sich schickt, kam der endlose Zug der Frauen. Obschon der Sindaco ledig geblieben war, hörte man lautes, wildes Frauenweinen. Das gehört zu einem richtigen Begräbnis.
Langsam zog das Geleite, dem schwankenden Sarg nach, durch die Kirchentreppe hinunter, an der verschlossenen Kirchentüre vorbei und in einem stattlichen Bogen auf den Kirchhof. Dort, vor der offenen Grube, wurden viele Reden gehalten. Jeder Freund des Verstorbenen – und wie viele hinterließ er! – wollte ihm etwas Gutes ins Grab nachsagen. Der Friedhof war zu klein für die vielen Menschen. Sie standen dicht gedrängt und zertraten die Gräber. Es war heiß. Mancher hätte gerne seinen Hut aufgesetzt oder den Kittel ausgezogen. Aber das ging nicht an. Erst um die Mittagszeit wurde der Sarg endlich in die Grube hinuntergelassen. Jeder streute eine Hand voll Erde darauf und stapfte über die Gräber davon. So leerte sich der Friedhof bald und nur noch die Buben hockten auf dem Dach der Totenkapelle, wohin sie geklettert waren, um besser zu sehen. Sie warteten auf etwas. Aber es geschah nichts Weiteres mehr. Maurilio, der Küster, schaufelte einen kleinen Berg über dem Grab zusammen, warf den Spaten auf die Schulter und ging auch fort. – Aus.
Der arme Sindaco war ein guter Freund des Herrn Martino gewesen. Beide hatten die Welt gesehen, Südamerika, beide hatten etwas Geld gemacht und waren nach Haus gekommen, um friedlich zu altern. Sie standen sich so nahe, dass sie sogar einen gemeinsamen Jagdhund besaßen, ein schönes, böses Tier, das sie sich aus Italien aus einer Zucht für viel Geld hatten kommen lassen. Denn beide waren gute Jäger. Nun ja, was war dabei? Männer sind, wie das italienische Sprichwort sagt, von Geburt her Jäger.
Der Tod des Freundes hatte Herrn Martino recht getroffen. Obschon er mit seinen roten Wangen und seinem spitzen Schnurrbart kühn und unternehmend aussah, so hatte er doch ein weiches Gemüt. Es hieß, er sei einmal auf der Gämsjagd am lichten Tag laut schreiend davongestürzt, weil ihn die unerschütterliche Stille der Berge jäh mit Entsetzen erfüllt habe. Auch war es ihm ungemütlich und er vermied es sorgfältig, wenn immer möglich, sich allein im alten Palazzo aufzuhalten. Die Hallen in den klösterlichen Gängen, die Blicke der alten Herrenbilder an den Wänden, die den Besucher still verfolgten, die Spiegel, das Krachen im Holzwerk, das alles beeindruckte ihn. Vielleicht hatte er auch Furcht vor den Gespenstern, von denen die alte Teresa früher gerne erzählt hatte. Sie sollten im blauen Zimmer herumpoltern und manchmal gewaltig an Teresas Kammertüre geschlagen haben. Wenn auch im Dorf alle wussten, dass die Teresa die Gespenstergeschichten nur erzählt hatte, um den Leuten Angst einzuflößen vor dem Haus, denn sie wollte ganz allein und ungestört sein, so schaute doch mancher abergläubisch daran empor, und sicher war auch Herr Martino, obwohl er fast jeden Tag in den Palazzo kam, um dieses oder jenes zu flicken oder zu richten, nicht frei von dieser Angst.
Seit dem Tode seines Freundes, des Sindaco, blieb er mehr zu Hause. Wenn man ihn traf, setzte er eine jämmerliche Miene auf und seufzte. Er sprach davon, manches sei ihm verleidet. So waren die Sciori nicht erstaunt, als er sie im Herbst darauf in der Stadt besuchte. Er war in ein neues Gewand gekleidet, sein Schnurrbart stand eingefettet spitzig auf beiden Seiten heraus. Ein Vetter von ihm, berichtete er, derjenige, der in Südamerika die vierzehn Millionen verdient hatte, «ja, verdient, was denn sonst?», dieser Vetter habe ihn nach Frankreich eingeladen, um Luft und Gedanken zu wechseln und für solange, als es ihm passen würde. Warum sollte er nicht zugreifen? Und so habe er sich auf den Weg gemacht. Er werde voraussichtlich einige Monate in Paris bleiben.
Darüber wunderten sich die Sciori nun doch. Ihr Herr Martino in Paris? Sie wussten, wie verhasst ihm jede städtische Kleidung war. Zu Hause ging er in verwaschenen Halbleinhosen, ohne Strümpfe, ein netzartiges Hemd mit Ausschnitt um seine hochgewölbte Brust gespannt und als Schutz auf seinem dunkeln Krauskopf einen ungewöhnlich reich durchlöcherten Strohhut. Und wie sollte er, der Bastler, es aushalten ohne Holz und Nägel, ohne Schlösser zum Ölen oder Flicken, ohne elektrische Anlagen zum Nachsehen, ja ohne die Ölheizung der Sciori, die nicht funktionieren wollte ohne ihn. Nur er wusste ihr so zuzusprechen, wusste an den richtigen Hebelchen zu drücken, verstand Luft und Öl so zu mischen, dass diese höchst weibliche Einrichtung ihre Pflicht tat. Vor allem, wie sollte Herr Martino leben ohne sein Boggiaspiel? Er spielte mit Leidenschaft, er spielte gut, aber nicht so gut wie der Schulmeister, nicht ganz so gut, denn der Schulmeister blieb kühl und seine Hand zitterte nie vor Zorn. Darum gewann er. Meist gewann der Schulmeister. Herrn Martinos Kopf wurde dann rot wie eine Tomate, er brüllte so laut, dass die Frauen, die auf der Piazza strickten, ihn hörten und sich zunickten: «Tino verliert wieder.» Aber doch, sooft der Schulmeister Zeit hatte, spielte Herr Martino mit ihm, um ihn zu besiegen. Wie sollte er ohne diesen täglichen Ansporn auskommen? Das schien den Sciori unmöglich. Sie machten ein großes Fragezeichen zu der geplanten Reise ihres Herrn Martino, doch wussten sie aus Erfahrung mit den Leuten aus dem Tal: Fragen nützte nichts. Man bekam keine richtige Antwort. Man musste warten. Einmal würde man schon verstehen, später, manchmal erst viel später … Und so wünschten sie dem Guten Glück auf die Reise.
In diesem Jahre waren die Sciori zu Weihnachten in ihr Landhaus gezogen, um den Festen in der Stadt auszuweichen. Es lag viel Schnee, als sie durch das Tal hinauffuhren, und in jedem Dorf standen viele Männer auf der verschneiten Straße, schauten und plauderten, zeigten sich mit ihren Bräuten oder trugen ihre kleinen Kinder herum. So ist es immer: auf Weihnachten kommen die Männer und Söhne nach Hause, die im Frühjahr in die großen Städte gezogen sind, um dort als Gipser und Maler ihr Geld zu verdienen. Im Tal findet ein Mann kein Auskommen. Das bisschen Heu und die wenigen, kleinen Kartoffeln genügen gerade, um die Ziegen, die Frauen und Kinder durchzubringen. Es sind geschickte Leute unter den Männern, die viel Geld verdienen. Das Geld – und die neueste Herrenmode – bringen sie an Weihnachten ins Tal. Es geht dann hoch her. Jeden Abend wird in den vielen kleinen Wirtschaften des Tales bis spät debattiert, über Politik und über Gemeinde- und Familienangelegenheiten. Oft gibt es gegen Mitternacht Zank und es heißt, wenn die Männer im Tal seien, so weinen die Frauen. Wie dem auch sei, es kommen dann im Herbst immer viele Kinder zur Welt. Manche davon sterben bald wieder. Man sieht in jener Zeit etwa eine einsame Frau mit einem kleinen Paket, das mit einer weißen Gardine verhangen ist, den Weg zur Kirche hinabgehen. Es ist eine Mutter oder Verwandte, die das tote Kind zuerst dem Pfarrer bringt, der in der offenen Kirchentüre wartend steht, unter lautem und besonders vergnügtem Geläute der Glocken, denn Gott freut sich über den Tod eines unschuldigen Kindleins, das direkt zu ihm in den Himmel kommt. Dann geleitet sie der Pfarrer auf den Friedhof, wo das kleine Paket von Maurilio, dem Küster, in eine winzige Grube verlocht wird. Nach kurzer Zeit weiß die Mutter nicht mehr genau wo.
Читать дальше