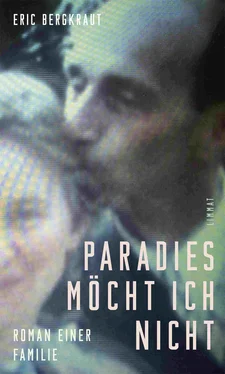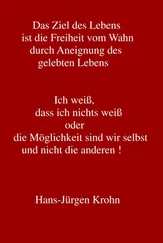Über dieses Buch
In einem Vorort von Zürich schießen im April 1943 zwei junge Menschen aufeinander zu. Felix ist gezeichnet von fünf Jahren Flucht und Fremdenlegion, Louise ist eine zornige Schweizerin, Jungkommunistin und Lehrerin in der Sonntagsschule. Beide sind hungrig nach einer besseren Welt, sie gründen eine Familie.
75 Jahre nach dem ersten Zusammentreffen seiner Eltern spürt ihnen Eric Bergkraut in seinem autobiografischen Roman nach, erzählt von diesen Leben in der großen Katastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts, folgt ihnen von Wien nach St. Maur und Paris, nach Albisrieden, Limoges, Fes und Aarau. Er erzählt von der List des Überlebens und der Last der Verfolgung, vom Lebenshunger und familiären Verstrickungen, den Spuren, die sich bei ihm und seinen Geschwistern niedergeschlagen haben, die er vielleicht bei seinen Kindern hinterlässt.
«Paradies möcht ich nicht» erzählt konzis und poetisch, tabufrei und warmherzig die individuellen Schicksale einer Familie im Strudel der grossen Geschichte bis zum heutigen Tag.
«Eric Bergkraut schreibt die Erinnerungen seiner Familie auf und baut eine Brücke über den Tod, die Pfeiler sind die wunderbaren, atmenden Details, welche die Vergänglichkeit abschaffen.» Michail Schischkin

Foto Ayşe Yavaş
Eric Bergkraut, geboren 1957 in Paris, ab 1961 aufgewachsen in der Schweiz. Ausbildung zum Schauspieler an der Schauspielakademie Zürich. Engagements am Theater sowie für Film und Fernsehen. Seit 1991 Dokumentarfilmer, u.a. über Anna Politowskaja, Agota Kristof, Peter Bichsel, Michail Chodorkowski).
Eric Bergkraut
Paradies möcht ich nicht
Roman einer Familie
Limmat Verlag
Zürich
In Erinnerung an Selma Bergkraut Bodmer und
Egon Bergkraut, meine Eltern. Mit großem Dank
an alle, die mir beim Schreiben geholfen haben.
In einem Vorort von Zürich fliegen im April 1943 zwei Menschen aufeinander zu. Sie treffen sich nur, weil rundherum Krieg herrscht. Sie stammen von unterschiedlichen Planeten, nichts hält sie auf. Louise ist sechzehn Jahre alt, zornige Jungkommunistin und zugleich Lehrerin in der christlichen Sonntagsschule. Felix ist zehn Jahre älter, Meister des Überlebens, gezeichnet von Flucht und Fremdenlegion. Beide sind hungrig nach einer besseren Welt; sie gründen eine Familie, sie sind meine Eltern.
Er holte mich im weißen MG am Bahnhof ab. Ich war im Zug unter dem großen Berg durchgerutscht, mit dem neuen Tunnel ging es schnell, es war kein Reisen mehr, bloß ein Abfahren, um möglichst bald anzukommen.
Jahrgang 1973 sei der Wagen, sagte mir Edmond, als wir eine der Kurven nahmen, die aus der Stadt in die Höhe führten; immer ähnlicher sah er unserem Vater im Profil, nur etwas voller im Gesicht war er; kein Staub lag auf dem Armaturenbrett, keine unnütz herumliegenden Gegenstände auf den Sitzen, bloß eine Schottenmütze auf der kleinen Rückbank, daneben mein schwarzer Rucksack. Ich musste an unseren Volvo denken und die leeren Joghurtdrinkflaschen, die Salzbretzel- und Cashewnutpackungen, die hinten auf dem Boden landeten wie in einer Müllzone.
Wir redeten nicht viel. Edmond war auf die Straße konzentriert. Ich mochte die Leere nicht ausfüllen, wir waren keine Geschwister, die in eine gemeinsame Melodie fallen konnten. Ich wusste nicht, weshalb er mich eingeladen hatte, vielleicht wollte er über den Tod unserer Schwester Catherine sprechen.
Sein Haus war klein, Sechzigerjahre, die Fassade efeubewachsen, hinten lag ein steil abfallender Garten mit zwei kleinen Terrassen, auf der ersten sah ich, geschützt, ein Teleskop stehen. Dem Schild hatte ich entnommen, dass er sich weiter nur «Ed» nannte und auch den zweiten Teil unseres Familiennamens abgeschnitten hatte, es wirkte als Lautfolge annähernd skandinavisch, vielleicht war es im englischen Sprachraum einfacher so.
Er fragte mich, ob ich die Schuhe ausziehen und die bereitstehenden Pantoffeln benutzen oder die Treter aus Filz überstreifen wolle, die gleichfalls parat standen. Ich entschied mich für die zweite Option und glitt über das Parkett aus Kirschholz, das offenbar neu eingesetzt war, der offene Kamin war verdeckt durch einen blau-roten Sessel, der mit seiner übergroßen Nackenstütze und den breiten Beinteilen bestimmt einmal futuristisch gewesen war.
Auf der kleinen Terrasse bot er mir Grüntee an, er streckte mir eine Holzbox entgegen mit gewiss zwei Dutzend Sorten, ich kannte nicht einmal den Unterschied zwischen japanisch, oben gestapelt, chinesisch, unten, und indisch in der Mitte. Ich griff aufs Geratewohl einen Beutel, japanisch, er schien zufrieden, ich auch, gegen alle Erwartung löste der Tee in meinem Hirn etwas aus, eine lichte Welle zog kurz durch meinen Kopf.
Er erkundigte sich nach der Karriere meiner Söhne, Juliette schien ihn weniger zu interessieren. Er erzählte, das Haus habe er noch von Australien aus gekauft und umbauen lassen, ein Architekt aus Mailand, das Gespräch verlief schleppend. Konnte ich ihn nach einem Weißwein fragen, der womöglich unsere Zungen etwas gelockert hätte? Ich war sicher: Das gab es in seinem Haus nicht, schon gar nicht stand in seinem Wohnzimmer eine Flasche jenes Pastis, den unsere Mutter oft etwas aufdringlich angeboten hatte.
Edmond schien zufrieden. Ich spürte, dass er den Abend genau geplant hatte. Gesprächspausen störten ihn nicht, das entlastete mich. So schwiegen wir eben, den Blick aufs Tal gerichtet und den kleinen Fluss, den man durch die Bäume mehr hörte als sah, in der Luft lag kaum Spannung, es war gut so.
Ich möchte dir etwas zeigen, sagte er nach einer Weile, und ich dachte zu erfahren, weshalb ich hier war. Er stand auf, wir traten ins Haus und er öffnete die Tür, die zum bergseitigen Zimmer abging. Er ging vor, flüsterte: Komm rein. Neben einer Art Gang stand hoch bis zur Decke eine Glaswand, dahinter lag eine Landschaft aus Steinen, zwei kahlen kleinen Bäumen und einem Tümpel.
Siehst du sie?, fragte er und zeigte zur rechten hinteren Wand. Tatsächlich entdeckte ich dort, eingerollt die eine, lang gezogen die andere, zwei glänzende Schlangen. Mein großer Bruder schien andächtig. Ich dachte an die Glaswand, hinter der seine Zwillingsschwester als Kind eine Zeit lang gelebt hatte. Aber ich sagte nichts. Ich spürte, ich sollte stehen und staunen, also tat ich so. Jede kriegt pro Tag zwei Mäuse, sagte er nach langer Pause und ohne den Blick von den Tieren zu wenden.
Später wurde japanisches Essen geliefert, es war auserlesen, in der Menge klug dosiert: Der Chauffeur blieb und trug als Kellner geduldig auf, eine solche Homedelivery war neu für mich. Ich genoss die Sushis und ihre Verwandten, deren Namen ich mir nie merken konnte, ans Schweigen hatte ich mich gewöhnt, es war wohltuend.
Nach dem Essen getraute ich mich, nach einem Kaffee zu fragen. Mein Bruder entschuldigte sich, ja natürlich, den bekäme ich, er brachte mir einen Espresso erster Güte.
Dann zog er einen Bildband hervor, der Abbildungen eines weiten Sternenhimmels zeigte, die ein japanischer Fotograf in einer australischen Sternwarte gemacht hatte, vielleicht holte er das Buch, weil der Tessiner Himmel dicht bedeckt war. Der Fotograf hatte die Fotos körnig aufgezogen und signiert, offenbar gab es von dem Buch nur wenige Exemplare, die Sterne schienen wie Gufechnöpf in ein dunkles Kissen gesteckt.
Ich wusste, auch dafür hatte er mich nicht eingeladen.
Die Sterne erinnerten mich daran, wie er uns allen, Vater lebte noch, vor Jahren feierlich erklärt hatte, biologische Verbindungen seien unwichtig. Hinderlich gar. Er wolle familiären Kontakt auf das Minimum reduzieren, das der Respekt gebiete, so hatte er es gehalten über all die Jahre hinweg.
Читать дальше