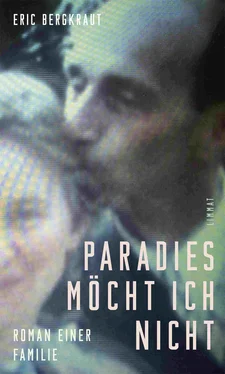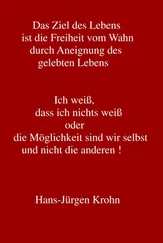Der Schlepper hatte sie vorausgeschickt und war am Ufer zurückgeblieben, das Gepäck, einen Rucksack und einen Handkoffer, hatte er ihnen abgenommen, damit sie besser durch das Flüsschen waten könnten. Als aber die Großeltern sich am anderen Ufer nach ihm umdrehten, war der Mann schon unterwegs zurück nach Saarbrücken und mit ihm ihre Habe.
Aranka und Rudolf waren in einem sprichwörtlichen Niemandsland, keinem Land zugehörig, sie gingen weiter, die Richtung ungefähr, da entdeckten sie nach einer Viertelstunde in der Ferne ein kleines, näherkommendes Licht, das stetig größer wurde, ein Glück ohnegleichen, es waren Richard und der elsässische Passeur, seit Stunden im Auto unterwegs, kreuz und quer.
Der Elsässer hatte seine Sache gut gemacht: Noch bevor das französische Zollhäuschen im Blick seiner Passagiere auftauchte, bremste er das Fahrzeug ab, fuhr im Schritt weiter, hupte lang und betont kräftig, die Großeltern lagen jetzt geduckt auf der Rückbank, niemand zeigte sich im Haus, in dem es dunkel blieb, man war in Freiheit.
Später, als der große Krieg ausbrach und die deutschen Truppen sich rasend schnell Paris näherten, wurde mein Großvater, von den Franzosen als feindlicher Ausländer betrachtet, in der Normandie eingesperrt, er konnte ja ein Spion sein, während meine Großmutter die Metro bis zur südlichsten Haltestelle nahm, Porte d’Orléans, und zu Fuß aufbrach durch den nicht besetzten Teil des Landes, vierhundert Kilometer weit.
Mein Vater Felix weilte zu diesem Zeitpunkt wie seine Brüder Richard und Theo in Nordafrika: Sie hatten sich für die Fremdenlegion verpflichtet, sie hofften, in den Krieg ziehen zu dürfen. Rudolf gelang es, mittels einer Leiter über den Zaun des Lagers zu klettern, er schlug sich bis nach Limoges durch, in die unbesetzte Zone, wo er Aranka fand, wenigstens war das Paar jetzt wieder vereint.
Gewiss hat zu diesem Zeitpunkt niemand aus der Familie Gedanken verschwendet an den Verbleib des Wiener Telefonbuches. Ich weiß, dass die Möbel aus Wien irgendwann im Jahr 1941 in Limoges angekommen sind. Sissy muss sich darum gekümmert haben, die Frau meines Onkels Richard, die als französische Jüdin Privilegien genoss.
Sie und Richard verkauften später in Limoges einen Teil dieser Möbel, das wurde ihr Geschäft, die Einnahmen teilte man sich in der Familie redlich. Aber wie kommt es, dass außer dem Telefonbuch heute auch ein aus Wien stammender sogenannter Servierboy aus Mahagoni bei mir steht? Warum wurde dieses Stück damals in Limoges nicht verkauft, wo es für die Familie doch dringend darum ging, zu Geld zu kommen?
Ich nehme an, dass das amtliche Teilnehmerverzeichnis aus Wien 1941/42 in Limoges war und vermutlich bis 1945 auch blieb, aber wo?
Es gab bald keine Wohnung mehr, die von Dauer war, die Brüder waren wieder zu den Eltern gestoßen, sie wechselten den Standort öfter, die französische Regierung verschärfte die Gesetze gegen Juden, es begannen Verhaftungen, Frauen waren noch ausgenommen, Männer kamen manchmal wieder frei, den Brüdern half, dass sie als ehemalige Soldaten Kontakte hatten zu amtlichen Stellen, mehrmals warnten Beamte vor anstehenden Razzien, die Résistance war in Limoges stark und gut organisiert. Die Monate vergingen und die Razzien in Limoges wurden systematisch, für die Kontaktleute wurde es gefährlich, die Flüchtlinge zu warnen. Einmal noch konnten sich die Brüder bei der Mutter eines bekannten Soldaten verstecken, als die französischen Milizen kamen.
Ab und zu nehme ich das rote Telefonbuch aus dem Regal und verliere mich darin. Es war Rudolfs amtliche Versicherung, zur Wiener Gesellschaft zu gehören. Er entstammte dem polnischen Ostjudentum, Assimilation war ihm wichtig gewesen und hatte ihn doch nicht geschützt. Auf dem Deckel oben rechts prangt der deutsche Reichsadler mit dem Hakenkreuz am Fuße, die erste Doppelseite ist unbedruckt, rechts steht groß in Rudolfs nach oben fliehender Handschrift sein Name.
In diesem Punkt hatte der Führer aus Braunau recht gehabt. Was er rausgekrächzt hatte, mit dieser gepresstesten aller Stimmen, war nicht mehr und nicht weniger als eine «Vollzugsmeldung», Österreich war parat gewesen. Zwei Monate nach diesem «Anschluss» war das neue Telefonbuch schon gedruckt gewesen. Nach Hinweisen wie «Nimm Dir ein Telefon, dann bist Du nicht allein», folgen direkt die NSDAP-Nummern: Von der «Arbeitsfront» bis zum «Zentralverlag der NSDAP», sie zeugen von der neuen Ordnung, die über diese Stadt gekommen war, als sei sie für ewig, dann erst begann das reguläre Buch mit dem Eintrag «Aaabas, Sicherheitsschlösser».
Mein Exemplar ist vermutlich 1945 von Limoges nach Paris gegangen, als Großvater Rudolf seinen Kindern aus der Schweiz dorthin folgte. Und 1961 von dort nach Aarau, als die Großeltern wiederum ihrem jüngsten Sohn nachzogen, das Schicksal hatte die Familie unentrinnbar verbunden.
Irgendwann hatte Großvater im ganzen Buch von 734 Seiten die Namen aller ihm persönlich bekannten Menschen rot angestrichen. Er kannte viele Leute, als ehemaliger k.u.k. Offizier, aktiver Sozialdemokrat und Mitglied einer Freimaurerloge. So reicht die Liste der Kolorierten von «Abeles, Ing. Erwin» bis zu «Zwecker, Dir. Wilhelm (Ruth)».
Auf Seite 167 fand ich einen überraschenden Gegenstand, ein getrocknetes, nicht vier-, sondern fünfblättriges Kleeblatt. Auf welchem Boden diese Pflanze einst gewachsen war und wie sie ins Buch gekommen ist?
Wenn Louise die Spielfigur bewegte und in ein neues Loch steckte, fiel mir auf, dass zwischen dem Handknochen im Vorlauf zum Zeigefinger und dem seitlichen Ansatz des Daumens gar kein Fleisch mehr war, nur Haut.
Mutter war dünn geworden, ich hatte sie ein paar Wochen lang nicht gesehen. Zum Tisch, vorne am Fenster, wo das Halmabrett stand, bewegte sie sich bevorzugt im Rollstuhl, manchmal ging sie an meinem Arm. In beiden Fällen drehte sich Louise eineinhalb Schritte vor dem Stuhl um und ließ sich, die Richtung einigermaßen einschätzend, rücklings in den Sitz plumpsen. Das machte mir jedes Mal Angst, erinnerte aber auch an den Moment, als ich erstmals gesehen hatte, wie der Hochspringer Dick Fosbury rücklings über eine Latte gesegelt war.
Das Spielfeld war eine runde Holztafel, ursprünglich vielleicht zur Benutzung als Schnittbrett in der Küche gedacht, mit regelmäßig eingebohrten Öffnungen. Als Spielfiguren dienten grüne und weiße Stifte mit feinen Rillen an den Seiten, nicht unähnlich jenen, die Ikea zur Montage von Gestellen mitliefert, womöglich waren es gar solche. Keine Ahnung, woher das Brett stammte, Mutter wusste es auch nicht, vielleicht aus einer Werkstatt handicapierter Menschen?
Mich erstaunte, wie Louise Sprünge nach vorne über Rückwärtszüge einleitete. Keck sei ich, meinte sie, wenn auch mir ein geschickter Zug gelang, beide wollten gewinnen, jedenfalls brauchte ich mich nicht absichtlich ungeschickt anzustellen, die zwei Züge, die ihr noch fehlten, als alle meine Figuren am Ziel waren, wollte Louise noch ausführen. Der Sportsgeist imponierte mir, und ich fragte mich, weshalb wir erst jetzt angefangen hatten, miteinander Halma zu spielen. Ich mochte die Ruhe, Konversation war nicht nötig, es war ein Spiel der Wiederholungen, auch wenn jede Konstellation einzig war.
Im dritten Stock des Hauses zur Bachwies, in dem sie jetzt lebte, ging es bunter zu als vorher im achten. Ein paar Bewohner hatten Ticks, ein Mann im Entree machte mit seinem rechten Arm stete Kreisbewegungen, ein anderer spielte ununterbrochen mit einer Perlenkette, wie man sie aus Griechenland kennt, andere lachten schrill oder schienen im Dauerschlaf. Insgesamt gab es hier, wie die leitende Ärztin sagte, weniger Kontrolle über die Psyche der Insassen und daher mehr Emotion als im achten Stock, wo sich die Damen und Herren dumpf von Medikamenten den ganzen Tag im Wohnzimmer aufhielten, meist ohne Regung.
Читать дальше